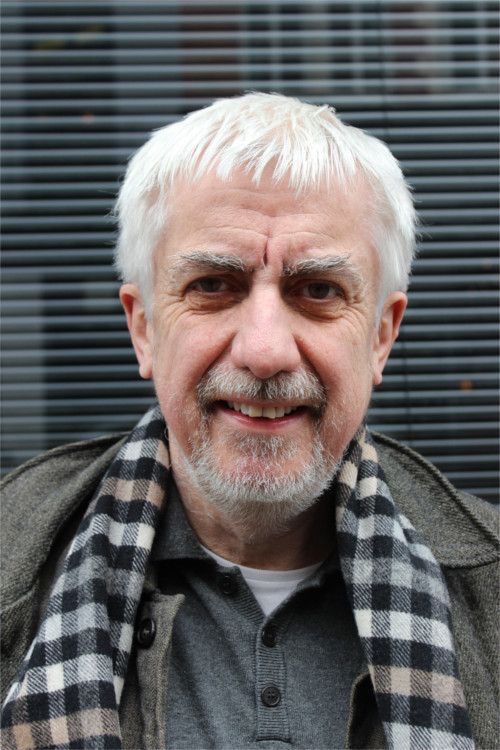Peter Pakesch: „Sie hatte sicher partiell Durchsetzungsprobleme“ Ein Gespräch über das Fördern der 2014 verstorbenen Künstlerin, aktuelle Ausstellungsprojekte und den besonderen Stellenwert der Arbeiten auf Papier

Maria Lassnig, Juni 1983, Foto: © Kurt-Michael Westermann/ Maria Lassnig Stiftung
Kurz vor Eröffnung der Ausstellung „Maria Lassnig – Zwiegespräche“ in der Albertina (→ Maria Lassnig: Zeichnungen und Aquarelle), traf ARTinWORDS Peter Pakesch, Vorstandsvorsitzender der Maria Lassnig-Stiftung. Ein Gespräch über das Fördern der 2014 verstorbenen Künstlerin, aktuelle Ausstellungsprojekte und den besonderen Stellenwert der Arbeiten auf Papier.
Das Gespräch für ARTinWORDS führte Alexandra Matzner.
- Maria Lassnig (liegend malen), Juni 1983, Foto: © Kurt-Michael Westermann/ Maria Lassnig Stiftung
- Maria Lassnig, Juni 1983, Foto: © Kurt-Michael Westermann/ Maria Lassnig Stiftung
Wie positioniert man eine Künstlerin wie Maria Lassnig?
ARTinWORDS: Sie positionieren die Künstlerin Maria Lassnig nach ihrem Tod international und bringen sie auch, man könnte fast sagen, „heraus“.Peter Pakesch: Positioniert war sie ja schon, aber es gibt trotzdem viel zu tun und vor allem viel zu koordinieren und zu schauen, dass die Dinge sich entsprechend weiterentwickeln.
ARTinWORDS: Wie viele Werke besitzt die Stiftung?
Peter Pakesch: Das kann man nicht so einfach sagen! Es sind sehr unterschiedliche Werke, weil die Stiftung Arbeiten aus allen Schaffensperioden – und vor allem auch sehr viele Werke auf Papier – besitzt. Es ist das Ziel, dass wir immer die Stärke haben, Retrospektiven gut ausstatten zu können. Das passiert auch zurzeit mit der Ausstellung für die Tate Liverpool, die jetzt in Essen zu sehen ist und demnächst in Warschau und Prag (→Maria Lassnig: Werke & Leben).
ARTinWORDS: Die Schau im Palazzo Pitti?
Peter Pakesch: Die Ausstellung in Florenz ist nicht aus unserem Beständen, für die haben wir nur ein, zwei Leihgaben dazugegeben. Unsere Bestände sind bei Hauser & Wirth, wo die Ausstellung „Maria Lassnig. A Painting Survey, 1950–2007’ in London gerade zu Ende gegangen ist. Im Weiteren läuft gerade eine Ausstellung in Athen in der städtischen Galerie. Dort ist „Maria Lassnig und die griechische Antike“ parallel zur documenta zu sehen. Für diese Ausstellungen – wie auch die Personale in der Albertina – konnte die Stiftung einen Großteil der Leihgaben bestücken.
ARTinWORDS: Neben der Organisation und der Beleihung von Ausstellung gibt es aber sicher noch weiter Aufgaben für die Stiftung, oder?
Peter Pakesch: Zum anderen ist es unsere Aufgabe, Bilder von Maria Lassnig in wichtigen Sammlungen unterzubringen.
ARTinWORDS: Soll das in Form von Schenkungen erfolgen?
Peter Pakesch: Primär in Form von Verkäufen. Durchaus aber auch, gelegentlich in Form von Schenkungen. Das hängt immer von den Plätzen ab.
ARTinWORDS: Wie finanziert sich die Stiftung?
Peter Pakesch: Genau aus diesen Verkäufen. Das war ihr Wunsch. Sie hat zuletzt mit Hauser & Wirth in London, Petzel in New York sowie Gabriele Wimmer von der Galerie Ulysses in Wien zusammengearbeitet. Sie hat alle drei in den Stiftungsvorstand berufen und damit ihrem Wunsch Ausdruck verliehen, über diese Galeristen, die ihr auch sehr viel gebracht haben, weiterzuarbeiten. Ich denke, dass die letzte Welle ihres internationalen Ruhms und des Erfolges sehr stark über diese internationalen Galerien gekommen ist.
- Maria Lassnig, März 2002, Foto: © Bettina Flitner
- Peter Pakesch, Vorstandsvorsitzender der Maria Lassnig Stiftung, Foto: © Josepha Pakesch
Später Durchbruch
ARTinWORDS: Maria Lassnig ist schon seit Jahrzehnten in der Kunstgeschichtsschreibung positioniert, wie Sie bereits angemerkt haben. Was ist in jüngster Zeit Neues an ihrem Werk entdeckt worden?
Peter Pakesch: Neues wird immer wieder entdeckt, was auch zeigt, dass sie eine große Künstlerin ist. Es hat zwei Momente gegeben, die sehr wichtig waren. Das eine war die Ausstellung in der Serpentine Gallery 2008 mit Hans Ulrich Obrist als Kurator.
ARTinWORDS: Es sitzt ja auch im Beitrat der Stiftung!
Peter Pakesch: Ja, durch ihn hat sich einiges noch viel stärker in Bewegung gesetzt, und er unterstützt die Arbeit der Stiftung sehr. Das Zweite war ein Dreigestirn an Ausstellungen: Es hat klein angefangen mit der Retrospektive „Der Ort der Bilder“ 2013 in Graz, die auch der Eckstein für das jetzt im Entstehen begriffene Werkverzeichnis war. Diese Ausstellung bildete den Kernbestand für eine Schau in den Deichtorhallen in Hamburg und vor allem jener 2014 im MoMA PS1. Alle drei Ausstellungen waren unterschiedlich, aber die MoMA PS1-Personale hat den großen Durchbruch gebracht. Das war auch die letzte Ausstellung, die Lassnig noch erlebt hat.
ARTinWORDS: Kann man sagen, dass man als österreichische bzw. europäische Künstlerin noch immer den Sprung über den Teich – in ihrem Fall sogar noch ein zweites Mal – schaffen muss?
Peter Pakesch: Ja!
ARTinWORDS: Wie sehen Sie es, dass die amerikanischen Sammlerinnen und Sammler von ihrer 1970er Phase in New York nicht so angetan waren?
Peter Pakesch: Da war Maria Lassnig die falsche Person am falschen Ort. Sie kam nach New York, als die Malerei, vor allem die gegenständliche Malerei nicht sehr viel gezählt hat.
ARTinWORDS: Trotz des Fotorealismus der 70er Jahre?
Peter Pakesch: Das war trotzdem eine andere Situation und eine andere Szene. Was sie gemacht hat, ihre realistische Malerei, die nie realistisch war, hatte nie etwas mit Fotorealismus zu tun gehabt. Das hat sie auch nie wirklich interessiert. Sie stand der Fotografie immer sehr skeptisch gegenüber. Lassnig war quergestanden in der amerikanischen Szene – und als Europäerin noch einmal mehr. Damals hatten amerikanische Künstler hauptsächlich in Europa Erfolge. Wenn europäische Händler und Kuratoren kamen, wollten sie Amerikaner sehen und keine Europäer. Das war für sie eine unglückliche Situation. Maria Lassnig konnte erst kontinuierlichen Erfolg genießen, als sie wieder zurück in Österreich war. Abgesichert durch die Professur, hat zuerst der deutsche Sprachraum sein Interesse gezeigt – das hat sich dann erweitert, bis Hans Ulrich Obrist kam und Händler wie Iwan Wirth und Friedrich Petzel.
ARTinWORDS: Man kann für Maria Lassnig zusammenfassen, dass sie der Erfolg erst sehr spät – aber Gott sei Dank noch zu Lebzeiten – ereilt hat. Hat das Ihrer Ansicht nach, auch etwas mit der Durchsetzung der Kunst von Frauen, feministischer Kunst zu tun?
Peter Pakesch: Partiell sicher! Sie hatte sicher partiell Durchsetzungsprobleme, aber es hing nicht nur damit zusammen: Sie konnte sich durchaus ihrem Erfolg auch selbst im Weg stehen! Es handelt sich also um eine Gemengelage von verschiedenen Aspekten, dann ist es auch die Vielfältigkeit ihrer Arbeitsmethoden dafür verantwortlich. Lassnig hat – zumindest nicht anfänglich – kein so ein stringentes Œuvre vermuten lassen wie andere.
Mehr als Körperbewusstseinsbilder
ARTinWORDS: Auch die aktuelle Rezeption von Maria Lassnig zeichnet ein vielleicht noch zu homogenes Bild.
Peter Pakesch: Jetzt weiß man, dass es ein sehr komplexes Œuvre ist, wo viele unterschiedliche Elemente mitspielen. Genau das, denke ich, macht heute die Qualität aus, war aber auch verantwortlich für eine bestimmte Durststrecke.
ARTinWORDS: Wir kennen Maria Lassnig als Schöpferin ihrer Körperbewusstseinsbilder. Was zeichnet sie zusätzlich aus?
Peter Pakesch: Das ist der Kern ihres Arbeitens, was sich in Allem ganz unterschiedlich niederschlägt. Das ist das Tolle! Es gibt wenige Künstler, wo der Körper auf so unterschiedlichen Ebenen abgehandelt wird. Der Körper von innen und von außen, im Empfinden, im Analysieren – und manchmal alles gleichzeitig auf einem Bild. Das macht ihr Werk so besonders!
ARTinWORDS: Ist der Körper das, was Maria Lassnig vom österreichischen Expressionismus – Stichwort Nötscher Kreis, ihr Besuch bei Franz Wiegele 1945 – übernimmt und ins 21. Jahrhundert weiterträgt?
Peter Pakesch: Interessanterweise ist in Österreich der Körper ein bestimmendes Thema. Vom Nötscher Kreis hat Maria Lassnig die Farbe mitgenommen, die bei ihr auch sehr wichtig und mit dem Körper verbunden ist. In diesem Zusammenhang findet man im Albertina-Katalog ein extrem interessantes Interview des Basler Kunsthistorikers Ralph Ubl mit der Künstlerin Miriam Cahn, die heuer auf der documenta groß präsentiert werden wird. Auch Cahn, die zwei Generationen jünger ist als Maria Lassnig, wurde zeitweise sehr vergessen. Es ist sehr schön zu sehen, dass man beide Künstlerinnen sehr nah nebeneinandersetzen könnte, weil auch in ihrem Werk Farbe und Körper große Rollen spielen. Miriam Cahn kann es aber sehr gut differenzieren und dies beschreiben.
- Maria Lassnig, Zwei Arten zu sein (Doppelselbstporträt), 2000, Öl auf Leinwand, 100 x 125 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
Ausstellungsprojekte
ARTinWORDS: Die Ausstellung „Maria Lassnig – Zwiegespräche“ in der Albertina ist die erste große Retrospektive nach dem Tod der Künstlerin in Österreich. Es gab letztes Jahr das Projekt einer Lassnig-Ausstellung im 21er Haus, das nicht zustande kam.
Peter Pakesch: Das Projekt des 21er Hauses ist jetzt dafür in Athen zu sehen. Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für Wien haben wir auch nach weiteren Stationen gesucht, die mehr mit dem Mediterranen und Antiken zu tun hatten. Da kam uns das Interesse von Denys Zacharopoulos, dem künstlerischen Leiter der Städtischen Galerie in Athen, sehr entgegen. Zacharopoulos hat lange an der Wiener Akademie am Institut für Gegenwartskunst gelehrt und ist der österreichischen Kunst sehr verbunden.
ARTinWORDS: Kommt diese Ausstellung dann doch noch einmal nach Österreich?
Peter Pakesch: Im Moment ist davon einmal nicht die Rede.
ARTinWORDS: Mit dem Antikenbezug würde die Ausstellung vielleicht ganz gut ins Kunsthistorische Museum passen.
Peter Pakesch: Im Moment sind wir in intensivem Gespräch mit der Glyptothek in Kopenhagen.
ARTinWORDS: Um über die Albertina hinauszudenken: Gibt es für Österreich schon konkrete Pläne einer weiteren Lassnig-Ausstellung?
Peter Pakesch: Im Moment noch nicht. Es ist in Europa jetzt schon einiges am Laufen. Wir sind daran größere Projekte für das Jahr 2019/20 anzupeilen. Wichtig ist auch noch, dass die Albertina-Ausstellung nächste Jahr im Kunstmuseum in Basel zu sehen sein wird.
Lassnigs autonome Zeichnungen und Aquarelle
ARTinWORDS: Basel plant die Albertina-Ausstellung gleichzeitig zu Art Basel zu zeigen. Die Albertina – um auf die Zeichnungen noch zu sprechen zu kommen – hat bereits Ende der 1970er Jahre Lassnigs Aquarelle gezeigt. Vor einigen Jahren gab es auch eine Sonderausstellung im Museum Ludwig. Offenbar war ihr das Präsentieren der Arbeiten auf Papier sehr wichtig.
Peter Pakesch: Natürlich! Bei ihr ist es ein eigener Werkkomplex, was sie so besonders macht. Daher bin ich auch sehr froh, dass die Albertina-Ausstellung sich so ausschließlich auf die Zeichnungen und Aquarelle konzentriert, weil man noch einmal eine Maria Lassnig kennenlernen kann, die eine ganz andere Konzentration hat. Die Verbindung zwischen dem Medium Papier, Zeichnung, Aquarell und dem sich darbietenden sowie umsetzenden Körpers ist noch einmal anders und spezieller als in der Ölmalerei. Das abgesondert zu präsentieren, ist für die Lassnig Stiftung eine besondere Gelegenheit.
ARTinWORDS: Wodurch ist der Unterschied für Sie so bedeutend? Sind die Zeichnungen noch „spontaner“?
Peter Pakesch: Die Arbeiten auf Papier haben eine andere Unmittelbarkeit! Als Malerin konnte Maria Lassnig auch sehr spontan sein, aber gestaltete doch sehr großflächig. Das gemalte Bild ist vertikal, es hängt gegenüber, auch wenn sie die Methode der Gestaltung bewusst ausgelotet hat. Es gibt auch Bilder, die sie liegend gemalt hat. Die Zeichnung passierte in einer anderen Intimität, was ich für sehr wichtig halte. Bei ihr wissen wir, dass es ganz andere Situationen und Gelegenheiten waren, wo sie gezeichnet oder gemalt hat. Diese beiden unterschiedlichen Welten haben natürlich viel miteinander zu tun, tangieren einander. Aber sie sind nicht unbedingt deckungsgleich.
ARTinWORDS: Wie autonom war die Zeichnung für Maria Lassnig?
Peter Pakesch: Absolut. Es gibt praktisch keine konkreten Vorzeichnungen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass sie immer wieder Motive aus Zeichnungen immer wieder zurückgegriffen hat und daran in der Malerei weiterarbeitete.
- Maria Lassnig, Die Illusion von meiner Tierfamilie, 1999 (Albertina, Wien © 2017 Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Selbstporträt mit Kochtopf, 1995, Öl auf Leinwand, 125 x 100 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
ARTinWORDS: Hier zeichnet sich ein spannender Dialog zwischen den beiden Medien ab, die zwar autonom angesprochen werden müssen aber trotzdem miteinander kommunizieren. Die Albertina-Ausstellung beginnt mit unglaublich frühen Zeichnungen, die zeigen, dass ein herausragendes Talent am Werk ist. Wie kam Maria Lassnig dann überhaupt auf die Idee Volksschullehrerin zu werden?
Peter Pakesch: Das war der Situation in den 30er und 40er Jahren in Kärnten geschuldet. Die Mutter hat sie zwar früh unterstützt, aber durch ihre Herkunft, die Situation, wie sie aufgewachsen ist, war das Selbstverstrauen, Künstlerin zu werden, nicht so groß.
ARTinWORDS: Ihr fehlten also die Rollenvorbilder.
Peter Pakesch: Das Studium in Wien war ein erster Schritt gewesen, um dann doch den Sprung nach Wien zu wagen und sich hier weiter entsprechend zu bewähren.
ARTinWORDS: Bevor sie endgültig nach Wien übersiedelte, kehrte sie doch noch einmal nach Kärnten zurück.
Peter Pakesch: Sie braucht einige Zeit, erst mit der Begegnung mit Exponenten der Nötscher Schule und gegen Ende ihres Studiums, das durch ihre Hinwendung zur Farbe konfliktreich endete, entstanden prägnante Werke erst um 1944/45. Erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Maria Lassnig künstlerisch eigenständig und verlässt den Schatten akademischen Imitierens. Ende der 40er Jahre stellte sie dann erstmals in Klagenfurt aus, was unter Umständen kein schlechter Zug war. Mit Arnulf Rainer gemeinsam wandte sie sich nach Paris, wo sie viele Leute kennenlernte. Dann braucht sie wieder fast ein Jahrzehnt, bevor Lassnig noch einmal nach Paris ging. Dort entstanden erste Werke, die ganz einzigartig sind.
ARTinWORDS: Sie war also jemand, der sich selbst viel Zeit gab, Gesehenes und Erlebtes zu verarbeiten.
Peter Pakesch: Es war uns bei dieser Retrospektive wichtig, dass man das auch sieht.
ARTinWORDS: Gibt es in der Albertina gerade ein Lieblingsstück von Ihnen?
Peter Pakesch: Lieblingsstücke gibt es viele. Der Viererzyklus aus New York, „The Murder of Maria Lassnig“ aus dem Jahr 1973, verarbeitete sie in einzigartiger Weise ihren Aufenthalt in New York. Einer der wichtigen Stars der Szene war Robert Smithson, der mit Spiegeln arbeitete. Es ist interessant zu sehen, wie Maria Lassnig ebenfalls Spiegel in diesen Werken einsetzte, und diese Methode wiederum auf ihren Körper umlegte.
ARTinWORDS: Viele Feministinnen der 70er Jahre arbeiteten mit Spiegeln.
Peter Pakesch: Das ist ein Aspekt, ich sehe darin aber dezidiert eine Anspielung auf Smithson. Das andere Lieblingswerk ist ein großes, frühes Aquarell, das fast ein Bild ist. Hier sieht man schön die Eigenständigkeit des Mediums.
- Lassnig, Murder of Maria Lassnig, Ausstellungsansicht „Maria Lassnig – Zwiegespräche“ in der Albertina 2017, Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS
Bilder
- Maria Lassnig, Juni 1983, Foto: © Kurt-Michael Westermann/ Maria Lassnig Stiftung
- Maria Lassnig (liegend malen), Juni 1983, Foto: © Kurt-Michael Westermann/ Maria Lassnig Stiftung
- Peter Pakesch, Vorstandsvorsitzender der Maria Lassnig Stiftung, Foto: © Josepha Pakesch
- Maria Lassnig, März 2002, Foto: © Bettina Flitner