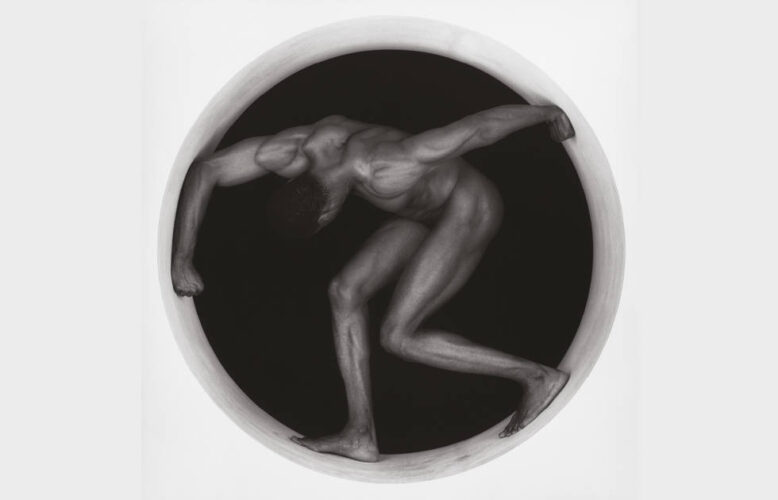Rubens’ Martyrium des hl. Andreas im Museo Thyssen Spätwerk des flämischen Malers im Kreis der Rubens-Sammlung

Peter Paul Rubens, Das Martyrium des hl. Andreas, Detail, um 1638/39, Öl/Lw, 305 x 216 cm (ohne Rahmen) (Fundación Carlos de Amberes, Madrid)
Peter Paul Rubens‘ „Martyrium des hl. Andreas“ (um 1638/39) aus der Stiftung Carlos de Amberes in Madrid ist als Gast im Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Das monumentale Spätwerk wird in der zentralen Halle des Palacio de Villahermosa gemeinsam mit weiteren Gemälden des flämischen Barockmalers präsentiert.
Rubens’ „Martyrium des hl. Andreas“ im Museo Thyssen
Spanien / Madrid: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
11.2. – 7.4.2019
„Das Martyrium des hl. Andreas“ (um 1638/39)
Das Gemälde zeigt jenen Moment, in dem Aegeas, der Prokonsul der römischen Provinz Achaea, den heiligen Andreas kreuzigen ließ. Zuvor hatte die Lehre des Heiligen zur Bekehrung des Großteils der Bevölkerung in der Provinz geführt. Auch die Ehefrau des Prokonsul hatte sich zum Christentum bekannt. Auch noch während seines Martyriums lehrte der heilige Andreas, bis die Bevölkerung sich gegen ihren Herrscher erhob. In diesem Moment versuchte Aegeas noch den Heiligen zu retten, doch dieser lehnte ab. Das Aushalten von Qualen während des Martyriums wurde in Rubens‘ Umkreis mit der stoischen Tugend der Standhaftigkeit verbunden.1 Seneca war der Auffassung, dass Freude sowie tapferes und standhaftes Ertragen der Folter auf die gleiche Quellen zurückzuführen seien, nämlich Seelengröße [animi magnitudo].2 In das gleiche Horn stieß auch Kardinal Gabriele Paleotti (1522–1597), wenn er forderte, dass Gewaltdarstellungen für die Passion Christi wie auch die Martyrien angemessen wären.3 Die himmlische Erlösung wird durch Rubens daher durch eine Lichterscheinung und die Märtyrerpalme tragende Putti visualisiert.
- Peter Paul Rubens, Das Martyrium des hl. Andreas, um 1638/39, Öl/Lw, 305 x 216 cm (ohne Rahmen) (Fundación Carlos de Amberes, Madrid)
Spätstil von Rubens
„Das Martyrium des hl. Andreas“ ist ein Hauptwerk der späten Schaffenszeit von Peter Paul Rubens und zeigt alle Charakteristika des Stils: Die Komposition stellt die Dramatik des Augenblicks mit Hilfe eine flächigen Verspannung der Figuren und Lichterscheinungen her. Anstelle einer räumlichen oder landschaftlichen Tiefe wirken die Figuren wie auf der vordersten Bildfläche arrangiert. Dazu kommt die für Rubens so typische Expressivität der Gesten, die hochbarocke Dynamik. Rubens wurde von den Zeitgenossen für seine klare Erzählweise geschätzt, die im Spätwerk mit grausiger Drastik zu kombinieren verstand. Rubens arbeitete mit einer großen Palette an Farben, die er mit flüssigem Pinselstrich auftrug. Dabei zeigt er sich tief vom Werk des Venezianers Tizian beeinflusst, dessen Werk Peter Paul Rubens im Prado studieren konnte.
Nachdem er sich Anfang der 1630er Jahre von seinen diplomatischen Ambitionen zurückgezogen hatte (→ XX), konnte sich Peter Paul Rubens mit aller ihm zugestandenen Freiheit (auch von Seiten der Auftraggeber!) dem Malen widmen. Martin Warnke beobachtete angesichts der „Kreuztragung Christi“ (um 1636/37) für den Hochaltar der Abteikirche von Afflighem, dass „das appellative Formenrepertoire der Frühzeit […] in diesem Spätwerk auf einen emotiven Kern zurückgeführt“ wird.4
Provenienz
Jan van Vucht, ein flämischer Repräsentant des Verlagshauses Plantin-Moretus in Madrid, bestellte das Ölgemälde für den Hochaltar der Kirche des ehemaligen Hospital de San Andrés de los Flamencos. Rubens übersandte mit dem Gemälde auch noch Instruktionen für die Gestaltung des Rahmens, der von den Hofkünstlern Philipps IV., Abraham Lers und Julien Beyma, ausgeführt wurde.
Im ehemaligen Hospital de San Andrés de los Flamencos befindet sich heute die Fundación Carlos de Amberes. Van Vucht vermachte Rubens‘ Werk 1639 dem Hospital de San Andrés, wo es bis in das frühe 19. Jahrhundert verblieb. Nach 1800 wurde das „Martyrium des hl. Andreas“ im Kloster von San Lorenzo de El Escorial und in der Königlichen Tapisseriemanufaktur verwahrt. Im 20. Jahrhundert gab es einige Versuche, das monumentale Werk zu kaufen und zu veräußern. Es überdauerte den Bürgerkrieg in Spanien und befand sich bis 1989 in den Sammlungen des Prado. Seit 1992 ist es wieder in der Fundación Carlos de Amberes.
Rubens im Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Rubens’ „Martyrium des hl. Andreas“ hängt für wenige Monate inmitten der Rubens-Sammlung des Thyssen-Bornsmisza, darunter „Die Blendung des Samson“, „Venus und Cupido“ „Porträt einer jungen Frau mit einem Rosenkrank“ und „Madonna mit Kind“ sowie „Hl. Elisabeth und Johannes der Täufer”.
Bild
- Peter Paul Rubens, Das Martyrium des hl. Andreas, um 1638/39, Öl/Lw, 305 x 216 cm (ohne Rahmen) (Fundación Carlos de Amberes, Madrid)
Literatur
- Martin Warnke, Rubens. Leben und Werk, Köln 2011.
- Nils Büttner, Ulrich Heinen (Hg.), Peter Paul Rubens. Barocke Leidenschaften (Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulreich-Museum Braunschweig, 8.8.–31.10.2004), München 2004.
Beiträge zu Peter Paul Rubens
Aktuelle Ausstellungen
- Ulrich Heinen, Das Martyrium der hl. Ursula, in: Nils Büttner, Ulrich Heinen (Hg.), Peter Paul Rubens. Barocke Leidenschaften (Ausst.-Kat. Herzog Anton Ulreich-Museum Braunschweig, 8.8.–31.10.2004), München 2004, S. 207.
- Seneca, epist. 66,12, zit. n. ebenda, S: 207.
- Ebenda, S. 207.
- Martin Warnke, Rubens. Leben und Werk, Köln 2011, S. 154.