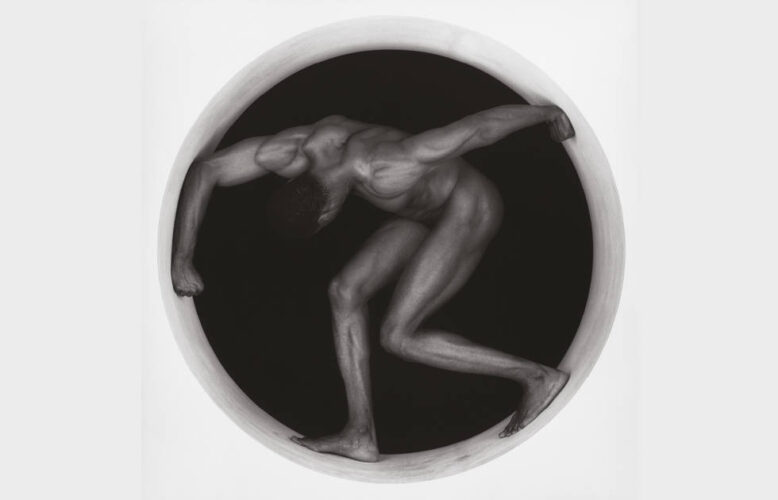Wien | KHM: Cranach. Die Anfänge in Wien Expressive Frühwerke und Kontakte zu Humanisten | 2022

Lucas Cranach der Ältere, Johannes Cuspinian, Detail, 1502
Um 1500 trat der bereits 30-jährige Künstler Lucas Cranach der Ältere plötzlich in das Licht der kunstbefliessenen Öffentlichkeit. Warum der 1472 in Kronach geborene Malersohn, der ab April 1505 in Wittenberg zu den erfolgreichsten Künstlern der deutschen Renaissance aufgesteigen würde, in Wien erste nachweisbare Werke hinterließ, gehört zu den Mysterien der Kunstgeschichte. Erstmals widmen sich Ausstellung und Buch ausführlich dieser frühesten bekannten Schaffensperiode Cranachs. Indem sie alle verfügbaren Werke - Gemälde, Druckgrafiken und Zeichnungen - vorstellt, wird ein angehender Meister greifbar, dessen expressiver Stil sich markant von dem der höfisch-eleganten Arbeiten seiner Zeit in Wittenberg unterscheidet! Cranach, der Wilde, wie ihn Kurator Guido Messling tauft, nutzte eine drastische Erzählweise, setzte Natur und Menschen in ein realistisches Maß und überzeugte als einfühlsamer Porträtist im Umfeld der Wiener Universität!
Cranach. Die Anfänge in Wien
Österreich | Wien: Kunsthistorisches Museum
21.6. – 16.10.2022
Lucas Cranach in Wien um 1500 – die Anfänge eines Künstlerstars
Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553) schuf seine frühesten bekannten Werke um 1500, kurz bevor er im Frühjahr 1505 seine Karriere als Hofmaler der sächsischen Kurfürsten in Wittenberg antrat: In Wien arbeitete er an eindrücklichen Porträts und Kreuzigungs-Szenen, kostbaren Zeichnungen und monumentalen Holzschnitten. Mit diesen Werken zeigt sich der junge, aber bereits technisch meisterhaft arbeitende Cranach sowohl engen Verbindungen zu den Humanistenkreisen um Konrad Celtis und Johannes Cuspinian auch als ein Wegbereiter der sogenannten „Donauschule“.
Erstmals darf das Doppelporträt von Johannes Cuspinian und seiner Frau aus der Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» in Winterthur nach Wien reisen. Diese außergewöhnliche Chance nutzt Guido Messling, Kurator für Deutsche Malerei am Kunsthistorischen Museum, für eine spannende Kabinettausstellung, in der er das medienübergreifende Werk Cranachs zusammenführt. Die eigenen Bestände erweitern Gemälde aus der Gemäldegalerie und dem Belvedere in Wien sowie dem Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg. Holzschnitte und Zeichnungen aus dem Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, der Österreichische Nationalbibliothek und der Albertina sind wichtige Ergänzungen zu den Tafelbildern, zeigen sie doch sowohl seine technische Perfektion als auch die persönliche Hand des Künstlers.
Leben und Werk Lucas Cranachs des Älteren vor 1500 liegen völlig im Dunkeln. Stilistische und technische Hinweise lassen vermuten, dass er in Nürnberg im Umfeld von Hans Pleydenwurff (um 1420–1472) ausgebildet worden sein könnte. Für Messling stellt Albrecht Dürers (1471–1528) monumentale „Apokalypse“ (1498) neben weiteren Arbeiten des Nürnbergers wichtige Ausgangspunkte für den jungen Cranach dar. Von diesen erzählfreudigen, detailreichen und dynamischen Kompositionen ausgehend, entwickelte Lucas Cranach einen drastischen Erzählstil, wie an der um 1500 zu datierenden „Schottenkreuzigung“ deutlich wird. Der Künstler zeigt nicht nur den geschundenen Leib Christi in spätmittelalterlicher Tradition, sondern lässt die blutende Zunge Jesu heraushängen! Im Kontrast dazu erscheinen die beiden Schächer zurückgenommen und wenig gemartert. Zwei Kohle-Zeichnungen auf rotgrundiertem Papier (Berlin) lassen ihre Tortur spürbarer werden als im Tafelbild. Cranach baut in dem kleinformatigen Andachtsbild gleichsam einen Spannungsbogen auf, um das Mitleid in der Christus-Figur zum Höhepunkt zu führen.
Das erste bekannte datierte Gemälde Lucas Cranachs ist der „Büßende hl. Hieronymus“ (1502) aus dem Kunsthistorischen Museum. Der Kirchenvater und sein zahmer Löwe haben sich in die „wilde“ Natur vor die Stadtmauer zurückgezogen. Hier widmet sich der Gelehrte der Übersetzung der Bibel in Latein und der Selbstkasteiung - der Sünder schlägt sich mit einem Stein gegen die Brust. Ob das Gemälde vom Humanisten Johannes Cuspinian oder dem Statthalter der niederösterreichischen Lande, Johannes Fuchsmagen, in Auftrag gegeben wurde, ist strittig. Vielleicht wichtiger als die Auftraggeberschaft ist die neue Bedeutung der Vegetation, die erstmals in einem realistischen Verhältnis zum Heiligen gezeigt wird. Mit dem „Büßenden hl. Hieronymus“ von 1502 positionierte sich der jugen Cranach als Wegbereiter der sog. „Donauschule“, in der Naturphänomene eine besondere Rolle zugesprochen würde. Die Auffassung, die Welt als Ausdruck eines göttlichen Willens zu sehen (Pantheismus), fand in Cranachs Werken einen ersten nachweisbaren Niederschlag in Wien.
Die gleiche Haltung zeigt Cranach auch im berühmten „Ehediptychon des Dr. Johannes Cuspinian und der Anna Cuspinian-Putsch“, das in den Jahren 1502/03 entstanden ist. Der Humanist und seine Ehefrau posieren nicht vor, sondern sitzen in der Natur, wie Messling betont. Die Landschaft im Hintergrund dient dem Maler u.a. als Aufenthaltsort für Apollo und die neun Musen, die er dem Paar zur Seite stellt. Ein Papagei, der vermutlich doch eher einen Phönix darstellen soll, wird Anna mitgegeben, während dem Ehemann ein Uhu mit einem Fasan in den Fängen, der selbst gejagt wird, zur Seite gestellt wird. Wer sich für die mannigfaltigen Interpretationen interessiert, sollte einen Blick in den Katalog werfen.
Kuratiert von Guido Messling, Kurator für Deutsche Malerei der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien (seit 2011), und Kerstin Richter, Leiterin der Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» in Winterthur (seit 2016). Die Ausstellung ist in erster Station in Winterthur und danach in Wien zu sehen.
- Lucas Cranach der Ältere, Johannes Cuspinian, 1502
- Lucas Cranach der Ältere, Anna Cuspinian-Putsch, 1502, Holz, 60 x 45 cm (Winterthur)
CRANACH. DIE ANFÄNGE IN WIEN: Ausstellungskatalog
Hg. Guido Messling, Kerstin Richter
Mit Beiträgen von K. Baumhoff, B. Blauensteiner, A. Fingernagel, S. Heiser, G. Messling, K. Richter
Deutsche & englische Ausgabe
160 Seiten, 70 Abbildungen in Farbe
20 × 24 cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-7774-3924-2 (dt.)
ISBN 978-3-7774-3926-6 (engl.)
HIRMER VERLAG