Maria Lassnig: Werke & Leben Ausstellung in Essen
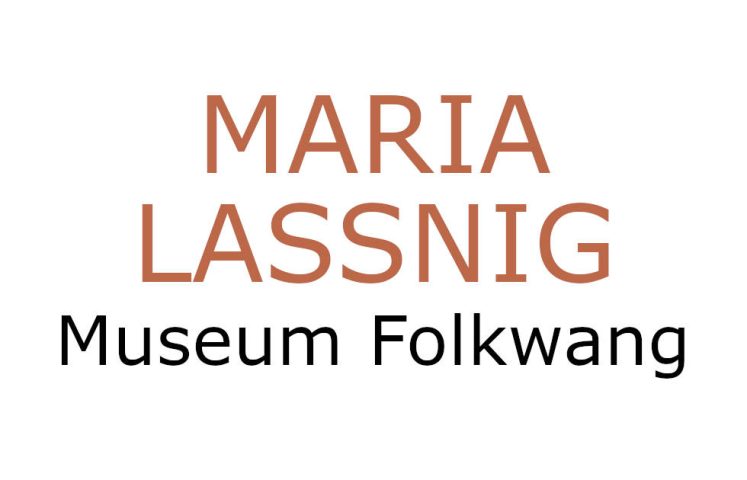
Maria Lassnig im Museum Folkwang
Maria Lassnig (1919–2014) gehört zu den wichtigsten Künstlerinnen der österreichischen Kunst des 20. Jahrhunderts. Bereits im Jahr 1948 stellte sie sich erstmals der Frage, wie sich das Bewusstsein für den eigenen Körper ins Bild übersetzen ließ. Nach einer ersten surrealistischen und informel-abstrakten Phase gelangte sie über die Rezeption kubistischer Akte zum Selbstporträt. Bereits während der 1960er Jahre entwickelte sie die für sie charakteristischen „Körperbewusstseinsbilder“, die sie ab 1970 auch in Animationsfilmen einsetzte. Mit der Rückkehr aus den USA, wo sie zwischen 1968 und 1980 hauptsächlich lebte, nach Wien und der Berufung Maria Lassnigs als Professorin für Malerei an der Hochschule für angewandte Kunst (heute: die Angewandte) und machten die österreichische Malerin zur ersten Professorin für Kunst im deutschsprachigen Raum. Im Alter von 61 Jahren setzte auch die internationale Würdigung ihres Werks ein: eine Teilnahme an der documenta 7 und X (1982, 1997) und drei Teilnahmen bei der Biennale von Venedig (1980, 1995 und 2013) sowie zahlreiche Preise wie den Österreichischen Staatspreis und den Goldenen Löwen der Biennale für ihr Lebenswerk (→ Maria Lassnig & Marisa Merz – Goldene Löwen 2013).
Maria Lassnig
Deutschland | Essen:
Folkwang Museum
10.3. – 21.5.2017
Selbstporträt expressiv
Bereits im Jahr 1945 zeigt sich Maria Lassnig in einem frühen Selbstbildnis als zeichnender Akt mit Kette um den Hals: Bewusst weiblich, man könnte sich an vergleichbare Selbstanalysen von Paula Modersohn-Becker erinnert fühlen, inszeniert sich Lassnig am Ende ihrer künstlerischen Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste in Wien und am Ende des Zweiten Weltkriegs. Professor Wilhelm Dachauer (1881–1951) kritisierte ihre Gemälde und warf die gebürtige Kärntnerin aus seiner Klasse. Daraufhin trat sie in die Klasse von Ferdinand Andri (1871–1956) ein und studierte Aktzeichnen bei Herbert Boeckl (1894–1966). Ein Besuch beim Kärntner Maler Franz Wiegele (1887–1944) hatte die Malerin 1942 auf die Spur des vom NS-Regime verbotenen Expressionismus gebracht. Die Werke von Wiegele und Boeckl übten die wichtigsten frühen Einflüssen auf die Selbstfindung der Künstlerin aus.
Nach Abschluss ihres Studiums kehrte Maria Lassnig nach Klagenfurt zurück. Ihr Atelier war zwischen 1945 und 1950 ein Treffpunkt von Künstlern und Schriftstellern. Das „Selbstporträt expressiv“ (1945) zeigt deutlich die Auseinandersetzung der Malerin mit der österreichischen expressiven Tradition. In der Klagenfurter Galerie Kleinmayr fand 1949 Lassnigs erste Einzelausstellung mit Gemälden und Zeichnungen statt (→ Maria Lassnig: Zeichnungen und Aquarelle).
Informel
Für die weitere Entwicklung von Lassnigs Werk war die zweite Hälfte der 1940er Jahre von entscheidender Bedeutung. Zum einen lernte die Malerin 1947 Arnulf Rainer (*1929) kennen, mit dem sie eine Beziehung einging. Ein Jahr später fertigte sie erste Body-Awareness-Zeichnungen an. Doch bevor Lassnig zu ihren Körperbewusstseinsbildern kam, schuf sie ab 1950 surrealistisch beeinflusste Zeichnungen und Drucke. Für kurze Zeit schloss sich Lassnig der so genannten Hundsgruppe an, die Rainer mitbegründet hatte. Die Vereinigung war stilistisch vielfältig und zählte u.a. informell arbeitende, abstrakte Maler wie Wolfgang Hollegha (* 1929) und Josef Mikl (1929–2008) zu ihren Mitgliedern.
Insgesamt drei Reisen führte das Künstlerpaar nach Paris, wo sie André Breton, Paul Celan und Gisèle Celan-Lestrange sowie Benjamin Péret und die tschechische Künstlerin Toyen (Marie Cermínová) kennenlernten. Toyen führte Marie Lassnig in den Surrealismus ein, den die Malerin als „Befreiung von der Tradition“ empfand“. Bei ihrem zweiten Besuch sah sie die Ausstellung „Véhémences Confrontées“ in der Galerie Nina Dausset. Die dort gezeigten informellen und abstrakt-expressionistischen Arbeiten von Künstlern wie Willem de Kooning (1904–1997), Hans Hartung (1904–1989), Jackson Pollock (1912–1956) und Wols (1913–1951) hinterließen bei ihr nachhaltigen Eindruck. Während der frühen 1950er Jahre entstanden Flächenteilungsbilder. Lassnig malte unter Einfluss des Informel „(Knödel-) Selbstporträts“ sowie erste „Körperwahrnehmungsbilder“ wie „Körpergehäuse“ (1951). In Reaktion auf die Ausstellung in der Galerie Nina Daudet organisieren Lassnig und Rainer im Künstlerhaus Klagenfurt die Schau „Junge unfigurative Malerei“, an der sie auch selbst teilnahmen. Die abstrakte Phase dauerte jedoch nur kurze zwei Jahre und sind von einem subjektiv gefärbten Konstruktivismus geprägt.
Konstruierte Körper
Zwischen 1955 und 1958 malte Maria Lassnig kleine, kubistisch beeinflusste Gemälde, auf denen Körper und Köpfe auf Farbflächen reduziert sind. Diese trug die Malerin mit dem Malspachtel auf. Die bevorzugte Farbigkeit setzt sich aus tonigen Grüntönen zusammen, die erst Ende der 1950er Jahre buntfarbigen Aquarellen Platz machte. Die Farbigkeit von Lassnigs Kunst ist an der Theorie des Expressionismus geschult: Die Künstlerin sprach von „Schmerz- und Qualfarben“, von „Nervenstrang- und Krebsangstfarben“. Wenn Maria Lassnig auch 1956 in einer Gruppenausstellung der Wiener Galerie nächst St. Stephan (neben vier männlichen Künstlern, darunter Rainer und Mikl) beteiligt war, so wird sie heute nicht zur Gruppe von St. Stephan gezählt – zu sehr ist diese lose Verbindung durch das maskuline Künstlerbild geprägt.
„Körpergehäuse: Als meine informelle Zeit in Gefahr war, in sterile Abstraktion auszuarten, hatte ich ein großes Verlangen, saftige Realitäten zu malen. Unter Verzicht auf die physiognomischen Wichtigkeiten der Augen, Nase, Mund, wurde der Kopf in Raumteile zerlegt, die Farbflächen der absoluten Graus wurden zu Wangenschildern, zu Stirnschildern, Halszylindern ausgebreitet und dem Hintergrund vorgesetzt. Weil der weiche Pinsel diesen harten Schnitten nicht entsprach, wurde das Palettmesser verwendet.“1 (Maria Lassnig 1985)
Körpergefühls-Bilder
Zehn Jahre nachdem Maria Lassnig zum ersten Mal über die Frage nachgedacht hatte, wie sie ihr Körpergefühl in ein Bild umsetzten könnte, schuf sie 1958 erste farbintensive Körpergefühls-Aquarelle. Lassnig empfand ihren Körper als Gehäuse., wie viele Bildtitel aus den 1950er Jahren wie auch Kommentare der Künstlerin belegen. Doch einfach ihre Hülle zu repräsentieren, war der Malerin nicht genug. Sie setzte „die im Körper vorhandenen Druck- und Spannungsverhältnisse“ und das „innere Körperdrama“2 bildlich um. Gleichzeitig gestaltete sie weiterhin informelle, gestische Ölbilder auf Leinwand. Unter den Werken dieser Umbruchsphase nimmt das Gemälde „Dicke Grüne“ (1961) eine Schlüsselstellung ein, verbindet die Malerin darin doch eine auf dem ersten Blick abstrakte Gestaltung mit einer Körperdarstellung, die durch den Bildtitel markiert wird.
Lassnig empfahl auch später noch ihren Studentinnen und Studenten, während des Malens nicht auf die Leinwände zu blicken. Zu sehr würde das Gesehene von den Empfindungen ablenken. Sie selbst richtete während der Arbeit ihren Blick nach innen, um ihren Körper schlussendlich auf der Leinwand von außen „darzustellen“. Dass das Innenleben nicht immer von äußeren Einflüssen befreit ahrgenommen werden kann, war sich die Künstlerin schmerzhaft bewusst. Um sich möglichst auf sich selbst konzentrieren zu können, legte sich die Malerin neben der Leinwand auf den Boden und hörte beim Arbeiten – auch mit geschlossenen Augen – in sich hinein. Das Sehen selbst thematisierte Maria Lassnig, indem sie – vor allem in den folgenden Bildern der 1970er Jahre – Apparaturen des Sehens wie Augenklappen oder Brillen darstellte oder den Augenbereich einfach aussparte. Im Gegensatz zur Überzeugung, dass die Augen Fenster zur Seele wären, entwickelte Lassnig das Konzept, dass sie gefühllos wären und daher nicht zwangsläufig motivisch wichtig.
Von 1961 bis 1968 lebte Maria Lassnig erneut in Paris. Es entstanden konstruktive Raumbilder, Körpergefühls-Figurationen („Strichbilder“). In die „Körperbewusstseinsbilder“ führte sie 1963 Deformationen und Merkmale von Tieren oder Ungeheuern ein. Der Tod ihrer Mutter im Jahr 1964 traf die Künstlerin tief. Ihre Trauer verarbeitete sie in der Serie „Beweinungsbilder“.
Amerikanischer Realismus: Lassnig in den USA
„Ich kam mit den Körperbewusstseinsbildern dort an. Die Amerikaner verstanden sie überhaupt nicht.“ (Maria Lassnig)
Jene Werkgruppe, die Maria Lassnig als „amerikanischen Realismus“ bezeichnete, entstand während der 1970er Jahre, als die Künstlerin hauptsächlich in New York City lebte. Sie wandte sich von den in den Sechzigern gefundenen abstrahierten und deformierten Körperbewusstseinsbildern ab und führte innere Wahrnehmung und realistisch wiedergegebene Körper zueinander. Damit reagierte die Künstlerin auf das Unverständnis ihrer amerikanischen Umgebung, Pop Art, Performance und Feminismus. Zusammen mit Martha Edelheit, Carolee Schneemann, Silvia Goldsmith und anderen gründete Lassnig 1974 „Women/Artist/Filmmakers, Inc.“. Die Gruppe organisierte Filmvorführungen unter anderem in Paris, Washington, New York, Wien und Brüssel. Lassnig reflektierte ihre prekäre Position als Künstlerin innerhalb des Kunstbetriebs in einer Serie von Selbstporträts, in denen sie Archetypen der Kunstgeschichte umdeutete – so in „Woman Laokoon“ (1976).
Im Jahr 1970 besuchte Lassnig einen Zeichentrickfilmkurs an der School of Visual Arts in New York und begann auf der Grundlage ihrer „Körperbewusstseinszeichnungen“ Animationsfilme zu gestalten. Darunter „Selfportrait [Selbstporträt]“ (1971), für den Maria Lassnig mit dem New York State Council Arts Award ausgezeichnet wurde, oder „Chairs“ (1971), in dem sie die Verschmelzung von Mensch und Sitzgelegenheit durchspielte.
„Amerikanischer Realismus: Realismus wurde für mich ein Ausnahmezustand, Beweis für Zweifler meiner Fähigkeiten, Freude an der sinnlichen Außenwelt, Trauer über die Seltsamkeiten und Teilnahme am Weltgeschehen.“3 (Maria Lassnig)
Metamorphosen und Altersporträts
„Innerhalb und außerhalb der Leinwand: Was mich reizte, war aber gerade diese Schwierigkeit. [Der Körper] ist mehr oder weniger das am schwersten zu malende Sujet. Etwas, das man eigentlich nicht sieht.“4 (Maria Lassnig 2006)
Im Alter von 61 Jahren - kurz nachdem sie Österreich gemeinsam mit VALIE EXPORT auf der Biennale von Venedig vertreten hatte - kehrte Maria Lassnig nach Wien zurück, wo sie an die Hochschule für Gestaltung (heute: die Angewandte) berufen wurde – und damit zur ersten Professorin im deutschsprachigen Raum. In den Körperbewusstseinsbildern der späten Jahre thematisiert sich Lassnig als Frau in verschiedenen Rollen, in einer zunehmend technologisierten Welt, in einer kriegerischen Welt. Sie verschmilzt in der Serie „Küchen Krieg“ mit Küchengeräten („Selbstporträt mit Kochtopf“, 1995; „Küchenbraut“, 1988) oder stellt ihre Verwundbarkeit in Krankenhaus-Bildern („Krankenhaus“, 2005) zur Disposition. Vor den „Ereignissen der Außenwelt“, wie dem Ersten Golfkrieg, kapitulierte die Künstlerin nicht, sondern reagierte in Gemälden wie „Sensenmann“ oder „Kriegsfurie“ auf ihn. Mit der Werkreihe „Innerhalb und außerhalb der Leinwand“ (1984/85) nimmt die Malerin erneut das Thema Selbstporträt auf und steigert es noch durch eine Meta-Malerei. Lassnigs Bildtitel „Die innige Verbindung zwischen Maler und Leinwand“ (1986), so postuliert Anna Fricke in ihrem Katalogbeitrag, „ist durchaus wörtlich zu verstehen“5.
„Ich arbeite an einer Form, die dem entspricht, dem irgendwie nahe kommt, aber eigentlich ist das fast unmöglich: Es vergeht von Sekunde zu Sekunde.“6 (Maria Lassnig im Gespräch mit Hanne Weskott im Februar und Juni 1995)
Maria Lassnig in Essen
Die Ausstellung „Maria Lassnig“ in Essen gibt einen Überblick über das malerische und filmische Werk der österreichischen Künstlerin. Dabei wird der Schwerpunkt auf die charakteristischen Body-Awareness-Pictures (Körperbewusstseinsbilder) gelegt, das abstrakte und kubistisch inspirierte Frühwerk wird am Beginn der Schau eher kursorisch abgehandelt. Zentraler Bildgegenstand ist das eigene Selbst, der Körper, die Affekte. Vom ersten bis zum letzten Raum zeigt die Retrospektive die Kraft der farbig leuchtenden Kompositionen, ihre koloristische Finesse und feinfühlige Introspektionen. Dazu gesellt sich eine reflektierte Haltung der Malerei an sich gegenüber, die sich in gemalten Leinwänden, Verdoppelungen des Selbst und die Präsenz von Pinseln in einigen Porträts zeigt. Die begleitende Publikation entstand für die erste Station der Ausstellung in der Tate Liverpool und wurde mit einem deutschen Begleitheft ergänzt.
Stationen der Ausstellungstournee:
- Polen | Warschau: Juli – Oktober 2017
- Deutschland | Essen: Folkwang Museum, 10.3. – 21.5.2017
- Tscechische Republik | Prag: Nationalgalerie, 16.2. - 17.6.2018
- Dänemark | Aalborg: KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, 17.11.2016 – 19.2.2017
- England | Liverpool: Tate Liverpool, 18.5.2016 – 18.9.2016
Maria Lassnig (Liverpool/Essen): Ausstellungskatalog
Kasia Redzisz, Lauren Barnes (Hg.)
mit einem Vorwort von Francesco Manacorda, Andrea Nixon (Tobia Bezzola im deutschsprachigen Einleger)
mit Texten von Kasia Redzisz, Lauren Barnes, James Boaden, Anna Fricke
Englische Ausgabe mit deutschem Einleger
144 Seiten, ca. 131 Abbildungen
ISBN 978-1-84976-432-2
Maria Lassnig: Bilder
- Maria Lassnig, Selbstporträt expressiv, 1945, Öl, Kohle auf Holzfaserplatte, 60 x 48 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Körpergehäuse, 1951, Öl auf Jute, 57 x 70 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Sitzender, 1956, Öl auf Holz, 50 x 34,5 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Figur mit blauem Hals, 1961, Öl auf Leinwand, 194 x 130 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Frühstück mit Ohr, 1967, Öl auf Leinwand, 230 x 195 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Selbstporträt mit Stab, 1971, Öl und Kohle auf Leinwand, 193 x 129 cm (Maria Lassnig Stiftung, © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Selbstporträt mit Maulkorb, 1973, Öl auf Leinwand, 96 x 127 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Innerhalb und außerhalb der Leinwand IV, 1984/85, Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Dame mit Hirn, um 1990, Öl auf Leinwand, 125 x 100 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Sensenmann, 1991, Öl auf Leinwand, 200 x 145 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung, Foto: Roland Krauss)
- Maria Lassnig, Selbstporträt mit Kochtopf, 1995, Öl auf Leinwand, 125 x 100 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Zwei Arten zu sein (Doppelselbstporträt), 2000, Öl auf Leinwand, 100 x 125 cm (Maria Lassnig Stiftung © Maria Lassnig Stiftung)
- Maria Lassnig, Krankenhaus, 2005, Öl auf Leinwand, 150 x 200 cm (Private Collection. Courtesy Hauser & Wirth © Maria Lassnig Stiftung, Foto: Archive Hauser & Wirth)
- Maria Lassnig, März 2002, Foto: Bettina Flitner
- Maria Lassnig, Wien 1983, Foto: Kurt-Michael Westermann
Biografie von maria Lassnig
1919
Am 8. September wurde Maria Lassnig in Kappel am Krappfeld, Kärnten (Österreich) geboren.1925
Lassnigs Mutter Mathilde Gregorz heiratete den Bäcker Jakob Lassnig: Umzug nach Klagenfurt.1939–1941
Ausbildung zur Volksschullehrerin und Arbeit in einer Volksschule im Kärntener Metnitztal.1940/41–1945
Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Professor Wilhelm Dachauer kritisierte ihre Gemälde und warf sie aus der Klasse. Daraufhin tratt sie in die Klasse von Ferdinand Andri ein und studierte Aktzeichnen bei dem Maler Professor Herbert Boeckl.1942
Besuch beim Maler Franz Wiegele.1945
Maria Lassnigs Atelier in Klagenfurt war Treffpunkt von Künstlern und Schriftstellern; es entstanden Porträts, Aktstudien, Interieurs und Stillleben. „Selbstporträt expressiv“1947
Bekanntschaft mit Arnulf Rainer, mit dem Maria Lassnig eine Beziehung anfing.1948
Lassnig fertigte erste Body-Awareness-Zeichnungen.1949
Erste Einzelausstellung mit Gemälden und Zeichnungen in der Klagenfurter Galerie Kleinmayr.1950
Fertigte surrealistisch beeinflusste Zeichnungen und Drucke wie die dicht gearbeitete „Verlorene Schlacht“, die in einer 1951 von der Hundsgruppe veröffentlichten Grafikmappe erschien. Zweite Einzelausstellung in der Galerie der Buchhandlung Kosmos in Wien1951–1953
Umzug nach Wien. Für kurze Zeit schloss sie sich auch der so genannten Hundsgruppe an, die Rainer ist mitbegründet hatte. Die Vereinigung war stilistisch vielfältig und zählte u.a. informell arbeitende abstrakte Maler wie Wolfgang Hollegha und Josef Mikl zu ihren Mitgliedern. Insgesamt drei Reisen nach Paris (gemeinsam mit Rainer), wo sie André Breton, Paul Celan und Gisèle Celan-Lestrange sowie Benjamin Péret und die tschechische Künstlerin Toyen (Marie Cermínová) kennenlernte. Toyen führte Marie Lassnig in den Surrealismus ein, den die Malerin als „Befreiung“ empfand“. Bei ihrem zweiten Besuch sah sie die Ausstellung „Véhémences Confrontées“ in der Galerie Nina Dausset; die dort gezeigten informellen und abstrakt-expressionistischen Arbeiten von Künstlern wie Willem de Kooning, Hans Hartung, Jackson Pollock und Wols hinterließen bei ihr nachhaltigen Eindruck. Lassnig gestaltete Flächenteilungsbilder und malte unter Einfluss des Informel ihre „(Knödel-) Selbstporträts“. In Reaktion auf die Ausstellung in der Galerie Nina Daudet organisierten Lassnig und Rainer im Künstlerhaus Klagenfurt die Schau „Junge unfigurative Malerei“, an der sie auch selbst teilnahmen.1952
Dritte Reise nach Paris. Einzelausstellung in der Galerie des Art Club. „Zwei Flächen übereinander / Schwarze Flächenteilung“1954
Rückkehr an die Akademie, um Malerei zu studieren. Kontakt mit den Schriftstellern der Wiener Gruppe, darunter Oswald Wiener, mit dem sie in späteren Jahren im Dialog bleibt. Einzelausstellung in der Zimmergalerie Franck, Frankfurt am Main.1955
Lassnig malte kleinen, kubistisch beeinflusste Gemälden, auf denen Körper und Köpfe auf mit dem Malspachtel aufgetragene Farbflächen reduziert sind.1956
Ausstellungsbeteiligung in der Wiener Galerie nächst St. Stephan (neben vier männlichen Künstlern, darunter Rainer und Mikl).1958
Erste farbintensive Körpergefühls-Aquarelle und informelle, gestische Ölbilder auf Leinwand.1960
Teilnahme an der Gruppenausstellung „Austrian Painting and Sculpture 1900 to 1960“ in der Arts Council Gallery, London.1961
Umzug nach Paris (bis 1968). Es entstanden konstruktive Raumbilder, Körpergefühls-Figurationen („Strichbilder“). Einzelausstellung im Landesmuseum Kärnten, Klagenfurt.1963
In die „Körperbewusstseinsbilder“ führte Lassnig Deformationen und Merkmale von Tieren oder Ungeheuern ein.1964
Tod der Mutter; Serie „Beweinungsbilder“.1966
Einzelausstellung in der Galerie Würthle, Wien.1968–1980
Maria Lassnig lebte überwiegend in New York, East Village in Manhattan (bis 1980), Sommerferien in Kärnten. Hinwendung zum Realismus, Stillleben mit verfremdeten Selbstbildnissen, Seidensiebdrucke, Animationsfilme.1970
Besuch eines Zeichentrickfilmkurses an der School of Visual Arts in New York und beginnt auf der Grundlage ihrer „Körperbewusstseinszeichnungen“ Animationsfilme zu gestalten. Einzelausstellung in der Neuen Galerie Graz, mit begleitendem Katalog.1971
Teilnahme an der Gruppenausstellung „Anfänge des Informel in Österreich, 1949 bis 1953“, im Museum des 20. Jahrhunderts, Wien.1972
Für den Animationsfilm „Selfportrait“ (1971) wurde Maria Lassnig mit dem New York State Council Arts Award ausgezeichnet.1974
Umzug in ein Atelier in der New Yorker Spring Street in SoHo. Zusammen mit Martha Edelheit, Carolee Schneemann, Silvia Goldsmith und anderen gründete Lassnig „Women/Artist/Filmmakers, Inc.“. Die Gruppe organisiert Filmvorführungen unter anderem in Paris, Washington, New York, Wien und Brüssel. Serie von Selbstporträts mit Tieren1976
„Woman Laokoon“1977
In der Wiener Albertina fand die erste Retrospektive zu Lassnigs grafischem Werk statt, begleitet von einem Katalog. Erhielt den Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst.1978
Lassnig erhielt ein DAAD-Stipendium und verbrachte ein Jahr in Berlin. Bis 1980 eine Reihe von Bildern in Aquarell und Gouache, deren Flächen in mehrere Rechtecke aufgeteilt ist, was an die Panels eines Storyboards erinnert. Einzelausstellung im Haus am Lützowplatz, Berlin.1979
Rückkehr nach New York, wo sie ein Apartment im 26. Stockwerk eines Wolkenkratzers an der First Avenue bezog: „Sexgöttin“ als erste einer kleinen Gruppe von Skulpturen in Bronze, Aluminium und Gips, die sie periodisch bis in die späten 1990er Jahre schuf. Teilnahme an der Graphics Biennale in Sydney.1980
Lassnig zog wieder nach Wien zurück, Professorin an der Hochschule für angewandte Kunst (heute: die Angewandte) und damit zur ersten Professorin für Kunst im deutschsprachigen Raum. Sie leitet die Meisterklasse für Gestaltungslehre – experimentelles Gestalten und lehrte Malerei, Zeichnen und Film. Gemeinsam mit VALIE EXPORT repräsentierte sie Österreich auf der Biennale in Venedig. Lassnigs Präsentation konzentrierte sich auf Gemälde aus den 1960er und 1980er Jahren sowie abstrakte Werke aus der Mitte der 1950er Jahre. In den 1980er Jahren rückt Lassnig von den für sie realistischen Darstellungen und Porträts ab. Rückkehr zur Abstraktion, malte „Körperbewusstseinsbilder“, erste mythologische und archaische Themen. Auf Reisen entstanden Aquarelle und Gouachen.1981
Einzelausstellungen in der Galerie Heike Curtze, Wien, sowie in der Galerie Klewan, München, mit begleitenden Katalogen.1982
Mit Gemälden aus den 1970er Jahren Teilnahme an der documenta 7. Im Rahmen von Lassnigs Klasse für experimentelles Gestalten wird ein Lehrstudio für Animationsfilm eingerichtet (bis 1989 in Betrieb).1984
Serie „Innerhalb und Außerhalb der Leinwand“, dann narrative, heitere Motive.1985
Erste Retrospektive von Lassnigs Malerei im Museum Moderner Kunst in Wien, anschließend im Kunstmuseum Düsseldorf, in der Kunsthalle Nürnberg und in der Kärntner Landesgalerie in Klagenfurt. Der Ausstellungskatalog enthält Schriften der Künstlerin über ihre Arbeit. Erhielt den Kärntner Landespreis. Lobte in ihrer Dankesrede die Unterstützung des österreichischen Staates für die Kunst hervor: „Es ist schön, wenn in einem Staate den Musen mehr zugesprochen wird als dem Gott Mars.“1988
Großer Österreichischer Staatspreis, der erstmals an eine Künstlerin verliehen wurde! In ihren Gemälden verschmelzen Haushaltsgegenstände und Maschinen mit Figuren.1991
Lassnig beginnt eine Gemäldegruppe zum Golfkrieg, darunter „Sensenmann“.1992
In Zusammenarbeit mit Hubert Sielecki entstand der Film „Maria Lassnig Kantate“, in dem die in Fantasiekostüme gekleidete Künstlerin vor einem animierten Hintergrund eine autobiografische Ballade aufführt.1993
Lassnig ist mit 42 weiteren Malerinnen und Malern aus drei Generationen in der Gruppenausstellung „Der zerbrochene Spiegel“ vertreten, die Kasper König und Hans Ulrich Obrist in der Kunsthalle Wien organisierten.1995
Teilnahme an der 46. Biennale in Venedig und an der 4. Istanbul Biennale. Lassnig integrierte Themen aus den Bereichen Technik, Elektrizität und Kybernetik. In ihren Tagebuchaufzeichnungen zu ihren Werken, die bei der 4. Istanbul Biennale ausgestellt wurden, ist die Rede von „Körperbewusstseinswerken“, in denen der Körper als „Elektrizitätsmaschine“ mit vibrierenden Sinneswahrnehmungen gesehen wird. „Kleines Science-fiction-Selbstporträt“.1997
Beendigung der Lehrtätigkeit im Alter von 78 Jahren, Teilnahme an der documenta X in Kassel, wo sie Zeichnungen aus den 1960er und 1970er Jahren zeigt.1998
Oskar-Kokoschka-Preis für bildende Kunst; existenzielle Themen (Illusionen, Verhältnis der Geschlechter, Vergänglichkeit, Tod und Zerstörung) – der Beginn einer Phase „drastischer Bilder“. Lassnig malte eine Reihe von Fußballerbildern.2001
Kunstpreis der Norddeutschen Landesbank Hannover2002
In Zürich mit dem Roswitha-Haftmann-Preis, mit dem Ehrenring der Universität für angewandte Kunst Wien und (als erste Künstlerin) mit dem Rubenspreis der Stadt Siegen ausgezeichnet.2003
Lassnig vertrat Österreich bei der 1. Beijing Biennale. Zyklus „Landleute“ (1996–2003).2004
Max-Beckmann-Preis der Stadt Frankfurt am Main.2005
Selbstporträts, auf denen sie zwischen Krücken oder unter den Laken eines Krankenhausbetts zu sehen ist – Einblicke in die Hinfälligkeit des Körpers und die belastenden Auswirkungen des Alters. „Kellerbilder“. Auftrag für die Gestaltung der Brandschutzwand in der Wiener Staatsoper, für den sie eine monumentale Version ihres Gemäldes „Frühstück mit Ohr“ (1967); Österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst2013
Preis für ihr Lebenswerk auf der 55. Biennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Lassnig vollendete ihr letztes Porträt, „Selbstporträt mit Pinsel“.2014
Am 6. Mai 2014 starb Maria Lassnig in Wien im Alter von 94 Jahren.
- Maria Lassnig, Über die Kopfheiten (1985), in: Maria Lassnig. Die Feder ist die Schwester des Pinsels. Tagebücher 1943–1997, hg. von Hans Ulrich Obrist, Köln 2000, S. 25. Zitiert nach Ausst.-Kat., S. 30.
- Siehe: Kasia Redzisz und Lauren Barnes, Einführung: Der Körper entscheidet, in: Ausst.-Kat., S. 4–9, hier S. 4.
- Maria Lassnig, Über die innige Verbindung von Maler und Malerei, in: Wolfgang Drechsler (Hg.), Maria Lassnig (Ausst.- Kat. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig), Wien 1999, S. 9–33, hier: S. 9. Zitiert nach Ausst.-Kat., S. 30.
- Maria Lassnig und Jörg Heiser, Inside Out, in: Frieze, Nr. 103, Nov.–Dez. 2006, S. 123. Zitiert nach Ausst.-Kat., S. 31.
- Anna Fricke, Im Bilde sein Maria Lassnigs Metabilder, in: Ausst.-Kat., S. 18–24, hier S. 19.
- Maria Lassnig im Gespräch mit Hanne Weskott im Februar und Juni 1995, in: Josef Helfenstein, Maria Lassnig. Zeichnungen und Aquarelle 1946–1995 (Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern) Bern 1995, S. 38. Zitiert nach ebenda, S. 19.
