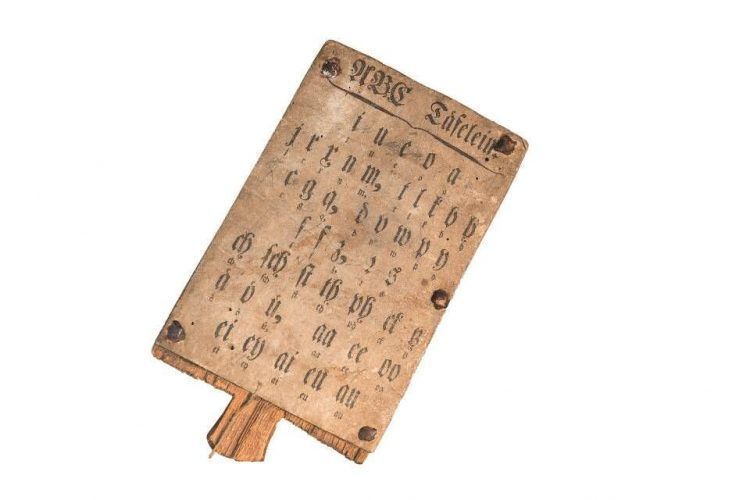Maria Theresia und die Kunst Kunst- und Kulturförderung in Wien während des 18. Jahrhunderts | 2017

Friedrich Heinrich Füger, Kaiserin Maria Theresia im Kreise ihrer Kinder, 1776, Tempera auf Pergament 34,2 x 39 cm Rahmenmaße: 48 x 53 x 6 cm © Belvedere, Wien
Maria Theresias Ruf als Kunstförderin ist nicht herausragend: Häufig bevorzugte sie wenig avancierte, dafür aber junge Künstler am Wiener Hof. Aus heutiger Sicht ist die größte und wirkmächtigste kulturpolitische Leistung der mariatheresianischen Zeit die Öffnung der kaiserlichen Sammlung im Oberen Belvedere für das allgemeine Publikum. Die bildende Kunst erfuhr nicht nur aus propagandistischen Gründen kaiserliche Unterstützung, wobei der Landschaftsmalerei mit den Bildern von Johann Christian Brand erstmals größere Bedeutung zukam.
Maria Theresia und die Kunst
Österreich | Wien: Belvedere, Unteres Belvedere
30.6. – 5.11.2017
So präsentiert die von Georg Lechner im Unteren Belvedere zusammengestellte Schau einen Überblick über Maria Theresias vielseitige Engagements für Malerei und Bildhauerei; Kunsthandwerk – wie die von ihr nachweislich geförderte Wiener Porzellanmanufaktur – oder Möbelkunst bleiben in dieser Ausstellung leider ausgespart. Dass in der Mitte des Rundgangs auch noch der so genannte „Donnerbrunnen“ steht und dieser nicht als Teil der Ausstellung angesehen wird, ist konsequent, kann aber durchaus amüsieren. Das populärste bildhauerische Werk Georg Raphael Donners war ein Auftrag der Stadt Wien und wurde bereits 1739 am Namenstag Kaiser Karls VI. aufgestellt. Die nackten Allegorien des Flusses Traun erregten jedoch unter der Regierungszeit von Maria Theresia angeblich so viel Anstoß, dass die Figuren 1773 entfernt wurden.
- Einblick in die Ausstellung Maria Theresia und die Kunst im Unteren Belvedere 2017, Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS
Maria Theresia im Porträt
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Franz I. Stephan von Lothringen ließ sich Maria Theresia in Staatsroben malen. Das Belvedere setzt auf monumentale Bildnisse von Franz Anton Palko (1717–1766), dessen kapriziöser Rokoko-Stil sich vor allem am Prunk der Dargestellten festmachen lässt: die beiden posthumen Bildnisse für einen unbekannten Aufstellungsort von „Kaiser Ferdinand I.“ und „Kaiser Matthias“ (beide um 1760, Belvedere) sowie „Kaiser Franz I. Stephan“ (1756, Zisterzienserstift Lilienfeld) und ein jüngst Palko zugeschriebenes Bildnis von „Maria Theresia als Königin von Ungarn“ (wohl um 1755, Linea Collection, Bratislava). Die Gewänder und Draperien scheinen ein eigenes Leben zu haben, fallen beschwingt und bauschen sich voluminös. Der Kontrast zu Johann Gottfried Auerbachs (1687–1743) Porträts von Karl VI. und dessen Ehefrau Elisabeth Christine (beide um 1730) könnte nicht größer sein. Die beiden Messerschmidt-Büsten zwischen Palko und Auerbach führen die repräsentativen Bedürfnisse in die dritte Dimension über. Die berühmten Familienbildnisse des Martin van Meytens d. J. (1695–1770), welche die ständig wachsende Kinderschar des berühmten Paares würdevoll in Szene setzen, sind in dieser Schau nicht vertreten (→ Maria Theresia: Kinder, Kunst und Kinofilm), genauso ist „Maria Theresia als König von Ungarn“ (nach 1759, Belvedere) nur in einer Werkstattkopie vertreten. Dafür überzeugen die Pastell-Porträts von Jean-Étienne Liotard (→ Jean-Etienne Liotard (1702–1789)), die dieser während seines ersten Aufenthalts am Wiener Hof von Maria Theresia angefertigt hat, und die seine Werkstattmitarbeiter mannigfach kopierten (Ende 1743/Anfang 1744).
- Palko, Franz I. Stephan und Maria Theresia
Johann Christian Brand: naturalistische Landschaftsmalerei am Wiener Hof
Der neuen Bedeutung der Landschaftsmalerei folgend, werden die Werke von Johann Christian Brand (1722 –1795) im vorletzten großen Saal der Enfilade präsentiert. Knapp nach der Jahrhundertmitte erhielt er den Auftrag für Jagdbilder für die Ausstattung des Schlosses Laxenburg. Damit erschloss sich der junge Brand die Jagdvedute als neue Aufgabe, die er mit fiktivem, wie erhöhtem Betrachterstandpunkt geschickt löste. Diese Kompositionsmethode wandte der erfolgreiche Landschaftsmaler Jahre später auch für Schlachtendarstellungen an. Johann Christian Brand wurde 1766 mit dem Titel „k. k. Kammermaler“ geehrt und unterrichtete ab 1772 an der Wiener Akademie an der Landschaftszeichenschule.
Für den neu ausgebauten Blauen Hof zu Laxenburg arbeiteten Brand und der Franzose Jean Baptiste Pillement (1728–1808) in den Jahren 1765/66 gleichzeitig an idealisierten Landschaften. Die blauen Bilder des französischen Vedutenmalers bestechen durch ihre rokokohafte Duftigkeit, während Brand sich für seine Serie von 20 rottonigen Werken von der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts inspirieren ließ. Brand wählt den Weg des Naturalismus: Sein Gemälde „Schloss Hof vom Thebener Kogel aus gesehen“ (1774, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg), auch „Große Sandgrube“ genannt, bildet „den absoluten Höhepunkt nicht nur der Brand’schen Landschaftsvedute, sondern auch in der gesamten deutschen Landschaftsmalerei des 18. Jahrhunderts“. Angesichts dieses Naturalismus wäre ein Vergleich mit den 13 berühmten, zwischen 1759 und 1761 im Auftrag von Maria Theresia gemalten Veduten von Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, aus dem Kunsthistorischen Museum spannend gewesen. Leider konnte sich das Haus am Ring nicht von seinen Schätzen trennen.
- Johann Christian Brand, Wien Schloss Hof vom Thebener Kogel aus gesehen (Große Sandgrube), 1774 Öl auf Leinwand, 63,5 × 115,3 cm Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Inv.-Nr. Gm 1196, Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS
- Jean-Baptiste Pillement, Seestück mit Fischern und Segelbooten (ursprünglich im Blauen Pastellzimmer im Blauen Hof in Laxenburg), 1763, Pastell auf Papier auf Leinwand, 150 × 175 cm (Wien Museum, Inv.-Nr. 117.291) und rechts: Jakob Gabriel Mollinarolo, Ruhende Nymphe mit Hund, um 1770, Blei, 27 × 40,5 × 19,5 cm (MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst, Wien (als Dauerleihgabe im Belvedere, Wien, Inv.-Nr. Lg 2), Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS
Monumentalmalerei
Malerei war vor allem als Freskomalerei von Bedeutung, während mit Balthasar Ferdinand Moll (1717–1785) und Franz Xaver Messerschmidt (1736–1783) die beiden wichtigsten Bildhauer des 18. Jahrhunderts für Maria Theresia und Franz Stephan I. tätig waren. Die Ausstellung im Belvedere beleuchtet alle Kunstgattungen und die Künstlerausbildung an der Akademie der bildenden Künste in Wien, die unter Staatskanzler Wenzel Kaunitz-Rietberg einen neuen Impuls erhielt.
Besonders spektakulär sind die Ölskizzen des römischen Freskomalers Gregorio Guglielmi (1714–1773) für die Große und die Kleine Galerie in Schloss Schönbrunn. Der hier entwickelte Himmel voller Allegorien und Personifikationen steht prototypisch für die Regierungszeit Maria Theresias. Das Herrscherpaar ließ sich meist in Form von Medaillonporträts repräsentieren, umgeben von ihren Herrscherinsignien und den wirtschaftlichen Leistungen ihrer Länder.
- Gregorio Guglielmi, Die Huldigung der habsburgisch-lothringischen Länder mit ihren Produkten, Entwurf für den zentralen Deckenspiegel der Großen Galerie in Schloss Schönbrunn, um 1760, Öl auf Leinwand, 111 × 166 cm (Musée du Louvre, Paris, Département des Peintures, Inv.-Nr. R.F. 1939-30), Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS
- Franz Anton Zauner, Perseus und Andromeda, 1777 Bez. und dat. am Felsen: Zauner fec. / Roma / 1777, Gips, getönt, H: 78 cm (Belvedere, Wien, Inv.-Nr. 1759) Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS
- Wilhelm Beyer (frühere Zuschreibung an Balthasar Ferdinand Moll), Kaiser Franz I. Stephan, 1770/80, Marmor, 200 × 90 × 68 cm (Belvedere, Wien, Inv.-Nr. 2241) Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS
Maria Theresias Erbe
Zu den von Maria Theresia angestoßenen und finanzierten kulturellen Leistungen, die bis heute sichtbar sind, zählen zweifellos der Ausbau von Schloss Schönbrunn zur Sommerresidenz (→ Maria Theresia: Kinder, Kunst und Kinofilm) sowie die gründliche künstlerische Ausbildung ihrer Kinder, die ihre Lieblingstochter Marie Christine und deren Ehemann Albert von Sachsen-Teschen zum Sammeln von Zeichnungen und Druckgrafiken animierte. Das Ehepaar trug ab den 1770er Jahren eine der bedeutendsten Kollektionen von Arbeiten auf Papier zusammen, die unter dem Namen Albertina bis heute unter den berühmtesten Sammlungen der Welt rangiert.
Kuratiert von Georg Lechner.
- C. Hirsch d.J., Der Krönungsritt Maria Theresias in Pressburg, 1747, Öl auf Leinwand, 45,5 x 33 cm © Galéria mesta Bratislavy
- Daniel Schmidely, Maria Theresia im ungarischen Krönungskleid, 1742, Öl auf Leinwand, 237,5 x 157 cm © Galéria mesta Bratislavy
- Johann Gottfried Auerbach, Kaiser Karl VI., 1730, Öl auf Leinwand, 262 x 188 cm © Belvedere, Wien
- Johann Gottfried Auerbach, Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, um 1730, Öl auf Leinwand, 262 x 188 cm © Belvedere, Wien
Die wichtigsten Künstler des 18. Jahrhunderts in Wien
Bildhauerei
- Georg Raphael Donner (1693–1741): Schuf den so genannten Donner-Brunnen am Mehlmarkt, der durch die von Maria Theresia eingerichtete Keuschheitskommission als anstößig, weil zu viel Nacktheit zeigend, klassifiziert worden war. Die Figuren mussten – auch aufgrund der schwierigen Materialwahl des Künstlers – entfernt werden.
- Matthäus Donner (1704–1756): Als Medailleur in Diensten der Habsburger (→ Maria Theresia. Medaillen).
- Giovanni Giuliani (1664–1744): Wichtigster Bildhauer der Familie Liechtenstein und als solcher verantwortlich für die skulpturalen Ausstattungen des Garten- und des Stadtpalais des Fürsten von und zu Liechtenstein.
- Lorenzo Mattielli (1667–1748)
- Johann Christian Wilhelm Beyer (1725–1796): Schuf die Skulpturen für den Park von Schloss Schönbrunn und publizierte seine Entwürfe.
- Joseph Resler (1702–1772)
- Balthasar Ferdinand Moll, Die Krönung Maria Theresias im Dom zu Prag zur Königin von Böhmen am 12. Mai 1743, Vier Reliefs mit Szenen aus dem Leben Maria Theresias und Franz‘ I., 1754, Blei-Zinn-Legierung, 63 x 111 cm © Belvedere, Wien
- Franz Xaver Messerschmidt, Franz I. Stephan, 1760, Bronze, feuervergoldet, 100 × 80 × 50 cm © Belvedere, Wien
- Franz Xaver Messerschmidt, Maria Theresia, 1760, Bronze, feuervergoldet 90 × 75 × 55 cm © Belvedere, Wien
Malerei
- Daniel Gran (1694–1757) war bereits von Kaiser Karl VI. gefördert worden.
- Paul Troger (1698–1762)
- Franz Anton Maulbertsch (1724–1796)
- Vertreter der Loth-Schule
- Josef Ignaz Mildorfer (1719–1775)
- Gregorio Guglielmi (1714–1773) war für die Freskierung der Großen Galerie in Schloss Schönbrunn verantwortlich.
- Johann Wenzel Bergl (1718–1789) malte die so genannten Bergl-Zimmer in Schloss Schönbrunn mit illusionistischen Gartenansichten aus.
- geborene Joseph Rosa d. Ä. (1726–1805): Landschaftsmaler, der ebenfalls in Schloss Schönbrunn die Rosa-Zimmer mit Landschaftsgemälden ausstattete. Zudem bekleidete er das Amt des Direktors der kaiserlichen Galerie (→ Barocke Gemäldegalerien und ihre Kataloge).
- Johann Christian Brand (1722–1795)
- Bernardo Bellotto genannt Canaletto (1722–1780): Veduten-Spezialist aus Venedig, der Ansichten von Wien und der Schlösser Schönbrunn und Schloss Hof schuf.
- Gabrielle Beyer, geborene Bertrand (1737–1802): Gabrielle Beyer fungierte auch als Zeichenlehrerin für die Kinder Maria Theresias.
- Heinrich Friedrich Füger (1751–1818): Ab Oktober 1776 lebte Füger mit Hilfe des Stipendiums der Wiener Akademie in Rom, um Skulpturen und Malerei der Renaissance zu studieren. Führender Porträtist und Historienmaler in Wien um 1800. Im Klassizismus wurde Füger Akademiedirektor.
- Anton von Maron (1731–1808) diente in Rom als Lehrer und Botschafter in künstlerischen Angelegenheiten.
- Christian Sambach (1761–1797) war u.a. für die Neugestaltung des Goldkabinetts im Winterpalais mitverantwortlich (→ Winterpalais des Prinzen Eugen von Savoyen).
- Martin Johann Schmidt, genannt Kremser Schmidt, war vor allem im heutigen Niederösterreich an der Ausstattung von Pfarrkirchen und Klöstern beteiligt.
- Daniel Gran, Aurora im Triumphwagen, Entwurf für das Deckenfresko des nördlichen Vestibüls in Schloss Hetzendorf, um 1747, Öl auf Leinwand, 25,5 x 72 cm © Belvedere, Wien
- Vinzenz Fischer, Die Jagd des Agamemnon, Entwurf für das 1766 entstandene Deckengemälde des Dianatempels in Laxenburg, 1763, Öl auf Leinwand, 63 x 63 cm © Belvedere, Wien
- Philipp Ferdinand de Hamilton, Fasane, 1745, Öl auf Leinwand, 79 x 98 cm © Belvedere, Wien
- Johann Christian Brand, Laxenburg von der Schneiderau gegen Guntramsdorf und Mödling, 1758, Öl auf Leinwand, 97 x 138 cm © Belvedere, Wien
- Johann Christian Brand, Küstenlandschaft mit Saumtieren, 1771, Öl auf Holz, 27 x 37 cm © Belvedere, Wien
Architektur
- Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723): entwarf Schloss Schönbrunn und die Karlskirche
- Johann Lucas von Hildebrandt (1668–1745)
- Jean Nicolas Jadot (1710–1761, ab 1737 in Florenz): Von 1750 bis Ende 1753 war Jadot in Wien für die Erweiterung der Kapuzinergruft und die Aula der Alten Universität verantwortlich.
- Nicolaus Pacassi (1716–1790): gestaltete das Innere von Schloss Schönbrunn im Rokoko-Stil
- Franz Anton Hillebrandt (1719–1797) war für die Umbauten der Schlösser Halbturn und Hof verantwortlich.
- Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1733–1816): Auf Hetzendorf gehen die Ausstattung des Schlosstheaters in Schönbrunn sowie die Gartenarchitekturen im Schlosspark – darunter die Römische Ruine bis zur Gloriette – wie auch jenen in Schloss Laxenburg zurück.
Darüber hinaus prägten Wanderkünstler wie die Mitglieder der in verschiedenen Sparten tätigen Familie Carlone die österreichische Kunstregion.
- Franz Anton Maulbertsch, Huldigung für Kaiserin Maria Theresia Entwurf für das von Johann Veit Kauperz radierte und gestochene Frontispiz des fünften Bandes des „Supplementum Codicis Austriaci“, um 1769, Öl auf Leinwand, 31 x 20,5 cm © Belvedere, Wien
Maria Theresia und die Kunst: Bilder
- Johann Gottfried Auerbach, Kaiser Karl VI., 1730, Öl auf Leinwand, 262 x 188 cm © Belvedere, Wien
- Johann Gottfried Auerbach, Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, um 1730, Öl auf Leinwand, 262 x 188 cm © Belvedere, Wien
- Daniel Schmidely, Maria Theresia im ungarischen Krönungskleid, 1742, Öl auf Leinwand, 237,5 x 157 cm © Galéria mesta Bratislavy
- Hirsch d.J., Der Krönungsritt Maria Theresias in Pressburg, 1747, Öl auf Leinwand, 45,5 x 33 cm © Galéria mesta Bratislavy
- Philipp Ferdinand de Hamilton, Fasane, 1745, Öl auf Leinwand, 79 x 98 cm © Belvedere, Wien
- Daniel Gran, Aurora im Triumphwagen, Entwurf für das Deckenfresko des nördlichen Vestibüls in Schloss Hetzendorf, um 1747, Öl auf Leinwand, 25,5 x 72 cm © Belvedere, Wien
- Balthasar Ferdinand Moll, Die Krönung Maria Theresias im Dom zu Prag zur Königin von Böhmen am 12. Mai 1743, Vier Reliefs mit Szenen aus dem Leben Maria Theresias und Franz' I., 1754, Blei-Zinn-Legierung, 63 x 111 cm © Belvedere, Wien
- Johann Christian Brand, Laxenburg von der Schneiderau gegen Guntramsdorf und Mödling, 1758, Öl auf Leinwand, 97 x 138 cm © Belvedere, Wien
- Franz Xaver Messerschmidt, Franz I. Stephan, 1760, Bronze, feuervergoldet, 100 × 80 × 50 cm © Belvedere, Wien
- Franz Xaver Messerschmidt, Maria Theresia, 1760, Bronze, feuervergoldet 90 × 75 × 55 cm © Belvedere, Wien
- Vinzenz Fischer, Die Jagd des Agamemnon, Entwurf für das 1766 entstandene Deckengemälde des Dianatempels in Laxenburg, 1763, Öl auf Leinwand, 63 x 63 cm © Belvedere, Wien
- Franz Anton Maulbertsch, Huldigung für Kaiserin Maria Theresia Entwurf für das von Johann Veit Kauperz radierte und gestochene Frontispiz des fünften Bandes des "Supplementum Codicis Austriaci", um 1769, Öl auf Leinwand, 31 x 20,5 cm © Belvedere, Wien
- Johann Christian Brand, Küstenlandschaft mit Saumtieren, 1771, Öl auf Holz, 27 x 37 cm © Belvedere, Wien
- Friedrich Heinrich Füger, Kaiserin Maria Theresia im Kreise ihrer Kinder, 1776, Tempera auf Pergament 34,2 x 39 cm Rahmenmaße: 48 x 53 x 6 cm © Belvedere, Wien