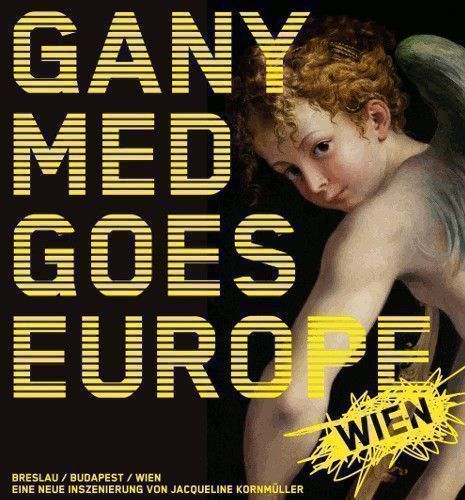Giuseppe Arcimboldo
Wer war Giuseppe Arcimboldo?
Giuseppe Arcimboldo (seltener auch Archimboldi, Arcimbaldo; Mailand * um 1526–11.7.1593 Mailand) war ein vor allem in Mailand, Wien und Prag tätiger Maler des Manierismus (→ Renaissance). Berühmt sind seine Tafelbilder, auf denen er Blumen, Früchte oder Gemüse, aber auch Gegenstände wie Bücher zu Porträts oder Stillleben arrangierte, die so genannten „teste composte“. Neben seiner Tätigkeit als Maler entwarf Arcimboldo Festdekorationen und war am Prager Hof auch als Ingenieur, Kostümbildner und Musiker tätig. Von seinen Werken ist nur ein Teil erhalten.
Arcimboldos künstlerische Laufbahn lässt sich in drei Phasen unterteilen:
- 1526–Ende 1562: Arcimboldis Lehrzeit und Laufbahn in Mailand bis zu seiner Abreise nach Wien an den Hof der Habsburger.
- März 1563–1587: Insgesamt 25 Jahre verbrachte Arcimboldo am Hof der Habsburger. Er diente drei Kaisern, Ferdinand I. (1503–1564), Maximilian II. (1527–1576, reg. ab 1564) und Rudolf II. (1552–1612, reg. ab 1576), als Porträtist, Erfinder der berühmten „teste composte [Kompositköpfe]“ und Festdekorateur.
- 1587–1593: Die letzten sechs Jahre lebte Arcimboldo in Mailand. Er war inzwischen ein erfolgreicher Künstler, der noch immer Gemälde nach Prag entsandte. Dafür wurde er in den Rang eines Pfalzgrafen erhoben. Geschickt nutzte er befreundete Schriftsteller, Historiker und Dichter, damit sie seine Kunst preisen.
Kindheit
Über Arcimboldos frühe Jahre ist kaum etwas bekannt. Leider überlieferte keiner seiner drei humanistischen Freunde, Giovanni Paolo Lomazzo, Paolo Morigia und Gregorio Comanini, die der betagte Arcimboldo mit der Abfassung von huldvollen Gedichten beauftragte, viel über Arcimboldos künstlerische Karriere vor seiner Abreise aus Mailand. Deshalb muss die frühe Biografie Arcimboldos auf Dokumente und Quellen gestützt werden.1
Die frühere Annahme, Arcimboldo sei 1527 geboren, stützte sich auf einen Eintrag in Mailänder Sterberegistern, wonach er im Alter von 66 Jahren starb. Aufgrund eines lange Zeit unbekannten Selbstbildnisses (Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, Genua), das die Jahreszahl 1587 und die Altersangabe 61 trägt, gilt nun 1526 als das wahrscheinlichste Geburtsjahr2
Arcimboldo und sein Vater waren traditionell mit der Mailänder Adelsfamilie Arcimboldi verbunden, deren Mitglieder (Juristen) in hochrangige Ämter gewählt wurden und die auch Bischöfe Mailands stellte. Es scheint, dass Arcimboldo nicht nur Morigia davon überzeugte, dass seine adlige Herkunft von einem viel älteren Zweig der Arcimboldis stammte, der auf Karl den Großen zurückgeht3, sondern sogar die Kaiser. Rudolf II. bestätigte ihm 1580 seinen Adelstitel erneut und verlieh ihm 1592 zudem den Titel eines Pfalzgrafen.4 Erst vor Kurzem wurde entdeckt, dass Arcimboldos Vorfahren über viele Generationen hinweg als Maler in kleinen lombardischen Dörfern gearbeitet hatten.5 Biagio Arcimboldo, Giuseppes Vater, ließ sich in einem Porträt von Bernardino Luini im edlen Profilporträt wiedergeben. Wenn nicht durch seinen Beruf und die Kunst der Malerei so könnte sich Biagio durch seinen Namen geadelt gefühlt haben.
Ausbildung
Giuseppe Arcimboldo dürfte seine Ausbildung bei seinem Vater Biagio absolviert haben. Für die weitere Karriere des Künstlers ist wichtig, dass die Stadt Mailand seit 1525 zum Herrschaftsbereich der Habsburger gehörte. Im Jahr 1560 wurde Karl Borromäus (reg. 1565–1584), ein entschiedener Anhänger der Gegenreformation, zum Erzbischof von Mailand ernannt.6 Während dieser Zeit war Arcimboldo, mit Ausnahme von Besuchen in den Jahren 1566 bis 1568, 1576/77 und 1581, die meiste Zeit nicht in seiner Stadt.7
Leonardo da Vinci und Arcimboldo – der Naturalismus der lombardischen Schule
Die lombardische Schule des 16. Jahrhunderts gilt als Wiege des Naturalismus, basierend auf der direkten Beobachtung der Natur.8 Leonardo da Vinci, der berühmteste Künstler der Stadt vor der Geburt Arcimboldos, prägte über 20 Jahre die Mailänder Kunst. Leonardos Stil beeinflusste die lombarische Schule bis weit ins 16. Jahrhundert hinein, denn neben prachtvollen Fresken und Gemälden, grandiosen Architekturprojekten und monumentalen Skulpturen hinterließ der Meister auch viele Manuskripte und Zeichnungen, in denen sein geistiges Erbe festgehalten ist.9 Der Haupterbe dieser Sammlung war Francesco Melzi, aber auch andere Schüler besaßen wertvolle Bücher mit Zeichnungen Leonardos, darunter Arcimboldos Kollege Aurelio Luini oder Ambrogio Figino10. Leonardo hatte in seinen Schriften die Bedeutung des Studiums und der Beobachtung der Natur betont, was sich in seinen Werken in einer Art Naturmystik niederschlug.
Leonardos Schüler setzten ihr intensives Naturstudium in ihren Werken fort. Eine Zeichnung Arcimboldos mit Reptilien und einem toten Chamäleon zeugt von seinem „wissenschaftlichen“ Interesse an der Natur.11 Ihr Entstehungsdatum 1553 fällt noch in seine Mailänder Zeit. Das Blatt erinnert an eine von Vasari vermittelte Geschichte von Leonardo, der ein Medusenhaupt auf einen Schild malte: Er brachte Salamander, grüne Eidechsen, Grillen, Schlangen, Schmetterlinge, Heuschrecken, Fledermäuse und andere merkwürdige Kreaturen in sein Zimmer, aus denen er ein „ganz schreckliches und furchterregendes Tier“ schuf.12 Der Herzog von Mailand kaufte den Schild – oder eine Version davon; Caravaggio reagierte darauf mit seiner schrecklichen Medusa (Uffizien, Florenz).
Leonardos großer Erfindungsreichtum erstreckte sich auch auf die dekorativen Künste.13 Im 16. Jahrhundert beschäftigte sich ein großer Teil der Mailänder Kunstszene mit Edelsteinschleiferei, Goldschmiedekunst, Juwelierhandwerk, Rüstungsherstellung, Seidenweberei, Bronzeguss und ganz allgemein mit der Herstellung exquisiter Luxusgegenstände.14 Diese Objekte waren ausschließlich für den Export an die exklusivsten Höfe Europas bestimmt. Viele dieser Handwerker arbeiteten nach Zeichnungen, die ihnen von Malern zur Verfügung gestellt wurden. Man sollte deshalb die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Arcimboldo zu Beginn seiner Karriere an solchen Aktivitäten beteiligt war. Es ist zumindest bekannt, dass der hochbetagte Künstler nach seiner Rückkehr nach Mailand vom Kaiser, seinem jüngeren Bruder und anderen Mitgliedern des Hofes Aufträge erhielt, eine Reihe seltener Objekte aus kostbaren Materialien wie Ebenholz, Elfenbein, Bergkristall und Edelsteinen herzustellen. Darunter befanden sich Schreibtische, Schlitten und Bergkristallplatten.15
Hinzu kommt, dass die Grotesken Leonardos auch im Norden bekannt waren und nicht nur Hieronymus Bosch, sondern auch Künstler wie Quentin Massys und Jan Massys beeinflusst hatten. Der Austausch zwischen Nord und Süd, insbesondere im burlesken und satirischen Genre, war viel dynamischer, als gemeinhin angenommen wird.16
Werke
Mailand
Die erste Erwähnung von Giuseppe Arcimboldo stammt aus dem Jahr 1549, als er gemeinsam mit seinem Vater an der Ausschmückung des Mailänder Doms arbeitete. Aus den Akten des Mailänder Doms geht hervor, dass diese Arbeiten bis 1559 andauerten.
Bereits 1518 hatte Giuseppes Vater Biagio für die Veneranda Fabbrica del Duomo in Mailand zu arbeiten begonnen; er entwarf jahrzehntelang Kartons für die Buntglasfenster des Mailänder Doms. Im Jahr 1549 schloss sich ihm Giuseppe an, der fast zehn Jahre lang für die Fabbrica arbeitete und eine Reihe von Kartons zeichnete, aber auch Wappen und Banner malte und andere kleinere Arbeiten ausführte. Vater und Sohn zeichneten zahlreichen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament sowie aus dem Leben der Heiligen. Giuseppe Arcimboldo wird ein deutlich dynamisierter Stil zugeschrieben. Seine Szenen zeichnen sich durch dynamischere Bewegungen der Figuren und gewagtere räumliche Strukturen aus.17
Im Jahr 1556 wurde Arcimboldo beauftragt, gemeinsam mit Giuseppe Meda und anderen weniger bekannten Malern die Fresken im Dom von Monza zu malen.18 Sein Beitrag zum monumentalen Fresko des Lebensbaums lässt sich vielleicht an den großen gelben Zitronen erkennen, die an jene Früchte erinnern, die an der Brust des „Winters“ hängen.
Vier Jahre später, 1560, lieferte Arcimboldo der Kathedrale von Como den Karton für einen Wandteppich mit der Darstellung der „Dormitio Virginis [Marientod]“, dessen Mittelteil durch eine konventionelle und klassizistische Komposition auszeichnet und von einem Fries aus üppigen, mit Naturelementen und Früchten verflochtenen Girlanden eingerahmt wird. Dies zeigt bereits Arcimboldos Liebe zu phantasievollen Dekorationen.19 Es ist schwierig, sich ein klares Bild von Arcimboldos Stil in dieser Zeit zu machen. In dieser Zeit war es weit verbreitet, Projekte von mehreren Händen ausführen zu lassen, und seine – heute verlorenen – Projekte wurden zudem oft von anderen Künstlern in andere Medien übertragen.
Dokumenten zufolge arbeitete Arcimboldo während seiner Zeit in Mailand ausschließlich für religiöse Kunden. Das einzige Arcimboldo zugeschriebene Porträt aus seiner frühen Mailänder Phase findet sich im Inventar des Grafen Giovanni Anguissola von 1578. Seine Tätigkeit am kaiserlichen Hof – zunächst in Wien, dann in Prag – beweist jedoch vielseitige Interessen, die Arcimboldo eine breite und abwechslungsreiche Palette von Aufträgen ermöglichten. Daraus lässt sich schließen, dass er bereits in Italien den Nachweis erbracht haben muss, dass er über einige dieser Eigenschaften verfügte.
Ausgehend von diesen frühen Werken bleibt es ein Rätsel, wie Arcimboldo zu einer solchen Berühmtheit gelangen konnte, dass Maximilian II. ihn nach Wien berief. Wir können nur vermuten, dass er weitere Arbeiten – für private Auftraggeber – ausgeführt hat, von denen jedoch keine dokumentarischen Spuren mehr vorhanden sind.
Wien
Arcimboldo war bereits 36 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Mailand verließ, um am Hof der Habsburger sein Glück zu suchen. Hier diente er unter drei Kaisern, zuerst in Wien und dann in Prag, und verdiente sich Ehrungen und finanzielle Belohnungen.
Arcimboldos Anwesenheit am Wiener Hof ist im März 1563 dokumentiert. Darin wird er als Maler namens „Joseph“ im Dienste seiner Majestät des Königs von Böhmen erwähnt, der im Auftrag Kaiser Ferdinands I.20 eine Reihe von Porträts kopieren sollte. Auf der offiziellen Gehaltsliste war Arcimboldo zusammen mit dem Maler Giulio Licinio21 als „Porträtist“ eingetragen. Arcimboldo blieb dort als sogenannter „Hauskonterfetter“ auch unter den Nachfolgern Ferdinands I., den Kaisern Maximilian II. und Rudolf II., tätig.
Der Kunsttheoretiker Giovanni Paolo Lomazzo, ein Zeitgenosse Arcimboldos, erwähnt zwei von Arcimboldo geschaffene Porträts: das von Kaiser Maximilian II. und das von König Philipp II. von Spanien22, und laut Morigia existierten „Porträts aller Mitglieder des österreichischen Hofes aus der Hand unseres Arcimboldo“. Wenn diese Information glaubwürdig ist, dann muss der Maler offizielle Hofporträts angefertigt haben. Sofern jedoch keine weiteren Beweise auftauchen, bleibt auch die Zuschreibung der Bildnisse der Erzherzoginnen im Bereich des Wahrscheinlichen (um 1563, KHM, Wien).23 Ferdinand I. ernannte ihn 1564 zum Hofmaler.
Kaiser Maximilian (reg. 1564–1576) war ein kultivierter und geistreicher Intellektueller, der zudem mehrere Sprachen beherrschte und seinen Hof zu einem kulturellen Zentrum ersten Ranges machte. Er zog Gelehrte aus ganz Europa an,24 darunter Humanisten und Gelehrte wie Wolfgang Lazius, Paulus Fabrizius, Jacopo Strada und Giovanni Battista Fonteo, aber auch Carolus Clusius, Rembert Dodoens, Ogier de Busbecq und viele andere25. Der Herrscher interessierte sich besonders für die Naturwissenschaften und ließ in verschiedenen Teilen der Stadt Wien – in Ebersdorf, im Prater und anderswo – zoologische und botanische Gärten zur Züchtung neuer Tier- und Pflanzenarten aus der Neuen Welt und Ostasien errichten. In seiner Leidenschaft konkurrierte Maximilian mit anderen europäischen Herrschern, insbesondere mit seinem Cousin, dem spanischen König Philipp II., der offenbar schon vor ihm in den Besitz seltener Exemplare gelangt war26.
Die Habsburger übertrugen ihm eine weitere wichtige Aufgabe: die Planung und Leitung der prunkvollen höfischen Feste. Maskenbälle und Maskenspiele waren eine internationale Kunstform, die sich an den europäischen Höfen großer Beliebtheit erfreute. Dabei beschränkten sich die Künstler nicht nur auf die Gestaltung von Triumphbögen und anderer ephemerer Architektur, sondern entwarfen auch Spiele, Tänze und Prozessionen unter aktiver Beteiligung der Herrscher, ihrer Familien und des Hofstaates. Es ist möglich, dass Arcimboldo bereits in seiner ersten Zeit in Mailand die Gelegenheit hatte, einige Aspekte dieser Feierlichkeiten zu leiten.27
Von diesen prunkvollen Veranstaltungen blieben nur Skizzen für Kostüme, Ungeheuer, Satteldecken und Entwürfe für elegante Kutschen. Von den vier Zeichnungskonvoluten, die Arcimboldo Kaiser Rudolf II. schenkte, ist heute nur noch eines bekannt (Florenz, Uffizien)28, das 150 Entwürfe für höfische Feste, Studien zu Kutschen enthält. Die Entwürfe zeichnen sich durch eine exquisite Fähigkeit zur metamorphischen Erfindung aus und tragen die Widmung an den Kaiser mit dem Datum.158529 Diese fragmentarische Zeichnungssammlung erweckt den Eindruck, dass Arcimboldo vor allem ein Schöpfer vergänglicher Wunderwerke war, was erklären würde, warum nur ein kleiner Teil seines Werkes überliefert ist, obwohl er 25 Jahre im Dienste des Kaisers stand. Gelegentlich, manchmal rein zufällig, tauchen Hinweise auf seine anderen Tätigkeiten auf. So weist die Zeichnung eines Brunnens darauf hin, dass der Künstler an der Gestaltung des Gartens für das von Maximilian am Stadtrand von Wien errichtete Palais Neugebäude beteiligt war, das sich an der von Giulio Romano entworfenen „Vorstadtvilla“ Palazzo Te in Mantua orientierte30.
„Vier Jahreszeiten“ und „Vier Elemente“ – „teste composte“
Neue Erkenntnisse sprechen dafür, dass die erste Serie der „Vier Jahreszeiten“ bereits in Mailand entstanden ist, und dass sie Arcimboldo nach Wien mitbrachte.31 Für eine frühe Datierung der Münchener Bilder spricht auch der Hinweis von Paolo Morigia (1592), einem befreundeten Zeitgenossen Arcimboldos, demzufolge der Künstler schon vor der Berufung nach Wien die ersten „teste composte“ entwickelt habe. Sommer und Winter blicken nach rechts, Frühling und Herbst nach links.
Bald darauf entstand in Wien die zweite, in der Komposition homogenere Bildfolge der „Vier Jahreszeiten“ und der „Vier Elemente“, die sog. Wiener Serie. Für Arcimboldo könnte die Zahl vier und ihre vielfältigen räumlichen Darstellungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle gespielt haben.32 Mit diesen „teste composte“ prägte er einen Kompositionsstil, der für ihn typisch wurde. Am Neujahrstag 1569 präsentierte Arcimboldo dem Kaiser seine bizarren und teilweise monströsen Kompositionen.
Arcimboldos Zeitgenosse, der Kunsttheoretiker Giovanni Paolo Lomazzo, nannte diese Kompositionen „teste composte“. Es handelt sich um verblüffende Porträts, die mit Blumen, Früchten, Tieren, aber auch Gegenständen (Attribute des jeweiligen Themas) gestaltet sind. Diese einzelnen Gegenstände arrangierte Arcimboldo so kunstvoll, dass sie sich mit Hilfe der Vorstellungskraft des Betrachters bzw. der Betrachterin zum Bild eines menschlichen Kopfes zusammenfügten. Damit nutzte Arcimboldo die antike Tradition der Personifikation. Zeitgenossen attestierten diesen assoziativen Bildern oft eine große Ähnlichkeit mit den dargestellten Personen. Oder, wie Kaiser Ferdinand I. beobachtete, aus der Ferne wirken Arcimboldos Köpfe wie Monster, aus der Nähe betrachtet allerdings überraschen sie durch die markanten Details.33
Mit diesem Konzept erweist sich Arcimboldo als markanter Vertreter des Manierismus, einer Stilrichtung der Spätrenaissance. Die Künstler der Renaissance hatten in der Wiedergabe der Natur einen hohen Grad an Perfektion und Harmonie erreicht. Der Manierismus lieferte einen Gegenentwurf bzw. eine damals moderne Erweiterung der Möglichkeiten. Einzelne Künstler wie Arcimboldo legten ihren Werken nun subjektive oder phantastische Vorstellungen zugrunde, die weit über die klassisch-harmonische Darstellung hinausgingen. Die allegorische oder enigmatische (rätselhafte, geheimnisvolle) Darstellung wurde zu einem wesentlichen Stilelement des Manierismus.
Giuseppe Arcimboldo schuf zahlreiche Bilder dieser Art, darunter ein Porträt des Kaisers Maximilian II. Für dessen Kopf fügte er Fische und Meeresfrüchte zusammen. Bekannt sind auch Arcimboldos Umkehrbilder, auf denen zunächst Stillleben aus Gemüse oder Blumen zu sehen sind; wenn die Bilder auf den Kopf gestellt werden, verändern sie sich zu Porträts.
Der Frühling (1555/60)
Das Gemälde "Der Frühling" gehört zur Serie der „Vier Jahreszeiten“, einem Thema, das Arcimboldo immer wieder aufgriff. Der Zyklus befindet sich heute in der Alten Pinakothek in München; das auf Holz gemalte Bild hat die Inv.-Nr. 2037.
Das Gesicht der Dargestellten ist aus Rosenknospen und einzelnen, nicht identifizierbaren Blüten zusammengesetzt. Das Ohr ist aus einer Pfingstrosenblüte geformt, eine Akelei bildet den Ohrring, während Maiglöckchen die Zähne darstellen. Das Haar besteht aus verschiedenen Blumen, eine Madonnenlilie ist als Zierde aufgesteckt. Das Kleid besteht aus grünem Blattwerk, erkennbar sind die Blätter von Kohl, Löwenzahn und Walderdbeeren. Der Kragen besteht aus weißen Blüten, darunter Margeriten.
Der Sommer (1555/60)
Das Gemälde "Der Sommer" gehört zur Serie der „Vier Jahreszeiten“, einem Thema, das Arcimboldo immer wieder aufgriff. Der Zyklus befindet sich heute in der Alten Pinakothek in München; das Bild hat die Inv.-Nr. 2038. Dort ist er seit 1598 in der Kunstkammer dokumentiert. Im Gegensatz zur späteren Wiener Fassung, ist dieses Bild weder signiert noch datiert.
Kaiser Ferdinand I. verbrachte seine Kindheit und Jugend in Spanien, wo er an der Seite seines Großvaters, König Ferdinands von Aragón (des Katholischen), die neuen Gartenanlagen in Valencia und Sevilla bewundern konnte.34 Er ließ deshalb in allen seinen Residenzen, vor allem in Wien, Prag und Linz, neue Gärten anlegen.35 Gärtner aus ganz Europa, vor allem aus Italien und Spanien, wurden herbeigerufen, um die Sommerfrüchte auch über den Winter zu retten.
Spielerisch schreibt Arcimboldo seinen Namen in den Kragen des Strohmantels und das Datum 1563 auf den Ärmelansatz der Schulter.
Der Herbst (1555/60)
Das Gemälde "Der herbst" gehört zur Serie der „Vier Jahreszeiten“, einem Thema, das Arcimboldo immer wieder aufgriff. Der Zyklus befindet sich heute in der Alten Pinakothek in München; das Bild hat die Inv.-Nr. 2039. Dort ist er seit 1598 in der Kunstkammer dokumentiert. Da das Werk in einem prekären Erhaltungszustand ist, wird es nicht verliehen.
Der Winter (1555/60)
Das Gemälde "Der Winter" gehört zur Serie der „Vier Jahreszeiten“, einem Thema, das Arcimboldo immer wieder aufgriff. Der Zyklus befindet sich heute in der Alten Pinakothek in München; das Bild hat die Inv.-Nr. 2040. Im Gegensatz zu anderen Darstellungen des Winters ist dieses Bild nicht durch ein Wappen oder ähnliches einer bestimmten Person gewidmet. Dieser allgemeinere Charakter der Darstellung machte sie zu einem perfekten diplomatischen Geschenk.
Der Frühling
Der Frühling befindet sich heute in der Sammlung des Prado, Madrid.
Vom Wiener Jahreszeiten-Zyklus sind nur noch drei Bilder erhalten; der Herbst gilt als verschollen. Giuseppe Arcimboldo begann die Serie bereits 1563 für Kaiser Ferdinand I.; nach dessen Tod wurde sie für Maximilian II. vollendet.
Der Sommer (1563 datiert)
Das 67 × 50,8 cm große Gemälde ist auf Lindenholz ausgeführt und ist Teil des Wiener Jahreszeiten-Zyklus. Die Signatur des Künstlers findet sich als Muster im Strohgeflecht von Kragen und Schulter: »GIVSEPPE/ARCIMBOLDO F«. Der Sommer befindet sich in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien und trägt die Inv.-Nr. 1589.
Die Personifikation des Sommers blickt nach rechts. Der Sommer setzt sich aus Getreide und Früchten zusammen, die den Reichtum der Jahreszeit symbolisieren: Arcimboldo nutzt einen Pfirsich als Wange, eine Weichsel als Auge, er setzte zwei Birnen als Lider ein und eine Gurke als Nase. Zwischen Kirschen öffnet sich als Mund eine Erbsenschote, den Hals bildet u.a. eine weiße Aubergine. Anstelle des Ohres findet sich ein Maiskolben – eine botanische Rarität, da erst von Columbus 1493 nach Europa gebracht. Dieser könnte auch als Teil einer Ohrenklappe der Kopfbedeckung zu lesen sein, die sich aus Obst, Gemüse und Blattwerk formiert – u.a. Kirschen, Pflaumen, Weintrauben und einem Salatkopf. Eine Ähre bildet als modisches Accessoire die Hutfeder, passend zum Strohmantel, der seidig glänzt, signiert (am Kragen) und (1563 auf der Schulter) datiert ist – als einziges Bild der Serie. Als Schmuck dient eine aus der Brust aufrecht herausragende Artischocke.
Der Winter (1563)
Das 66,6 × 50,5 cm große Gemälde ist auf Lindenholz ausgeführt und ist Teil des Wiener Jahreszeiten-Zyklus. Die Signatur des Künstlers befindet sich rechts unten: »GIVSEPPE/ARCIMBOLDO F.«. Es befindet sich in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien und trägt die Inv.-Nr. 1590.
Die Personifikation des Winters blickt nach rechts. Sein Gesicht und Hals sind aus einem knorrigen Baumstrunk gebildet, Nase und Ohr aus dem Astauswuchs, das Auge aus einer Rindenöffnung, der Mund aus zwei Baumschwämmen, das Haar aus wild gewachsenen Zweigen, die sich zu einer Art Krone formieren. Oberhalb der Brust ragt ein Zweig hervor, an dem zwei Zitronen hängen. Im Strohgewand verweist das »M« samt Feuereisen auf Kaiser Maximilian und den Orden des Goldenen Vlieses, den Hausorden der Habsburger, mit dessen Collane das Feuer aus der die Jahreszeiten ergänzenden Serie der Vier Elemente geschmückt ist. Auch wenn die Elemente erst drei Jahre später entstanden sind, korrespondieren die beiden Serien miteinander.
Das Feuer (1566)
Das 66,6 × 50,8 cm große Gemälde ist auf Lindenholz ausgeführt und ist Teil des Wiener Elemente-Zyklus. Die Signatur des Künstlers befindet sich rechts unten: »Josephus Arcimboldus/Milensis F.«. Es befindet sich in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien und trägt die Inv.-Nr. 1585.
Das Feuer gehört zu einem ursprünglich vierteiligen Zyklus, der drei Jahre nach dem Jahreszeiten-Zyklus entstanden ist. Vom Zyklus der Elemente sind zwei Werke noch im Kunsthistorischen Museum; die Erde befindet sich in Besitz des regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein. Die Luft ist verschollen bzw. in Kopien überliefert.
Beim Feuer bildet ein Feuerstein die Wange, ein Kerzenstummel das Auge, zwei Feuereisen Nase und Ohren. Aus Fackel und Öllampe formiert sich der Hals, wobei Korpus und Schnauze der Öllampe Kinn und Unterkiefer bilden. Der Oberlippenbart ist ein Bündel aus Anzündspänen, die Stirn eine Zündschnur, und die Haare sind aus brennenden Holzscheiten kreiert. Brust und Schulter setzen sich aus Feuerwaffen zusammen: Mörser, Kanonenrohr mit Pulverschaufel und Pistolenlauf. Den Hals schmückt die Collane des Ordens vom Goldenen Vlies, der Hausorden der Habsburger samt kaiserlichem Doppeladler – beides Hinweise auf den Adressaten der Serie.
Das Wasser (1566)
Das 66,5 × 50,5 cm große Gemälde ist auf Erlenholz ausgeführt und ist Teil des Wiener Elemente-Zyklus. Die Signatur des Künstlers befindet sich rechts unten: »Josephus Arcimboldus/Milensis F.«. Es befindet sich in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien und trägt die Inv.-Nr. 1586.
Das Wasser verblüfft mit überwältigender
Artenvielfalt. Über 60 im Wasser lebende Tiere – Fische, Amphibien, Reptilien, Säuge- und Krustentiere etc. – bilden die Büste.36 Nicht alle Tiere lassen sich bestimmen. Abgesehen von der Seemotte (hinter der Ohrmuschel) aus dem indischen Ozean stammen alle Tiere aus dem Mittelmeer – auffallend ist das Fehlen der für fürstliche Tafeln typischen Speisefische aus Meer und Süßwasser, wie Hering oder Forelle. Das Auge bildet ein Mondfisch, die Wange ein Rochen, die Nase eine Mittelmeermoräne, den Mund das Maul eines Hais. Das Ohr ist eine Archenmuschel, an der eine Austernperle als Ohrring hängt, Austernperlen bilden auch die Perlenkette, auf dem Haupteine Krone aus den Stacheln eines Seeigels. Brust und Schulter bestehen vor allem aus Krustentieren, die in Teilen an eine Rüstung erinnern: Die Brust schützt ein Taschenkrebs; auf der Schulter, die aus einem Tritonshorn besteht, hat ein Oktopus seine Tentakel ausgebreitet, die an Dekorum erinnern. Das Tritonshorn, eine rare Schneckenart, zeigt, wie begehrte Habsburger Sammelobjekte Aufnahme in die Kompositköpfe finden. Die zu vielen Kiemen des Hechtes im Halsbereich sind kein Zufall und erinnern an einen Rüstungskragen. Auch das Größenverhältnis der Tiere zueinander ist sekundär: An die kleine Robbe oberhalb des Ohres schmiegt sich ein vergleichsweise großes Seepferdchen. Trotz dieser künstlerischen Freiheiten ist Arcimboldos Interesse an einer detaillierten Wiedergabe der Natur offensichtlich und Teil seines Erfolgsrezeptes.
Die Erde (um 1566)
Das 70,2 cm × 48,7 cm große Gemälde ist auf Holz ausgeführt und ist Teil des Wiener Elemente-Zyklus. Es befindet sich in der Sammlung des LIECHTENSTEIN, The Princely Collections in Vaduz – Vienna und trägt die Inv.-Nr. GE 2508.37
Auch für die Erde sind zahlreiche Studienzeichnungen überliefert. Bestimmt war die Menagerie des Kaisers eine reiche Quelle für Studien nach der Natur. Die Allegorie setzt sich aus Säugetieren zusammen, die Anspielungen auf das Habsburger Kaiserhaus in sich bergen: Das Widderfell (Brust) verweist auf den Orden vom Goldenen Vlies, das Löwenfell (Rücken) auf Herkules, ihren mythischen Ahnherrn. Der Kopf ist geschmückt durch eine Krone aus Geweihen, wodurch die Habsburger auch als Herrscher über die Natur ausgewiesen sind. Zeitgenössischen Quellen zufolge geht die Anordnung der Tiere auf eine antike Beschreibung bei Plinius d.Ä. zurück, was auf einen Wettstreit (Paragone) Arcimboldos mit der Antike hindeutet. Möglicherweise ist die Erde etwas später entstanden, da die Maße im Vergleich zu denen des Wassers und des Feuers differieren.
Kaiserliche Geschenke
Arcimboldos teste composte wurden am Neujahrstag 1569 Kaiser Maximilian II. übergeben – zusammen mit einem panegyrischen Gedicht des Humanisten Giovanni Battista Fonteo als Kommentar zur Erklärung der Bilder: Der Kaiser herrscht nicht nur über die Menschen, sondern auch über die Natur, wobei die immer wiederkehrenden Jahreszeiten Symbol der ewig währenden Herrschaft der Habsburger sind.38
Nach Erhalt der Serie gab Maximilian die Anfertigung weitere Jahreszeiten für diplomatische Geschenke in Auftrag oder verschenkte Teile davon – u.a. an den Kurfürsten von Sachsen, einen der Wahlmänner des Kaisers (heute Paris, Louvre), oder an seinen Cousin Philipp II. in Spanien.
Eine zeitgenössische Beschreibung der Jahreszeiten
Der Arzt des Pfalzgrafen August von Sachsen, Dr. Johannes Neefe, beschrieb, das er im Februar 156439 ein Mittagessen bei Kaiser Ferdinand I. hatte, wo ihm dieser vier Gemälde eines „welschen“ Malers zeigte und erläuterte.40 Diese Gemälde waren an den vier Wänden
eines Raumes angebracht, und die dargestellten Gesichter symbolisierten die vier Jahreszeiten. Welche der beiden Serien Dr. Neefe gesehen hat, wird diskutiert: Für die Münchner Serie spricht, dass sie schon vollendet war.41 Die Wiener Serie war zwar schon begonnen, der Sommer trägt das Datum 1563, aber Anfang 1564 vielleicht noch nicht abgeschlossen.42 Gegen den Wiener Zyklus spricht vielleicht auch, dass die Serie als Ganzes erst 1569 Kaiser Maximilian II. übergeben wurde.
In Gesellschaft von Humanisten, Botanikern und vor allem von Ärzten diskutierte er auch anhand der Gemälde Fragen der Ernährung, der Flora, der Fauna, des Mikro- und Makrokosmos. Zu den Anwesenden gehörten v.a. Ärzte, die sich um die zunehmend prekäre Gesundheit des Kaisers bemühten, darunter Johannes Crato von Krafftheim, Stefan Laureus, Giulio Alessandrini, Giovanni Besozzi, Giovanni Odorico Melchiori und zeitweise auch Pietro Andrea Mattioli (Arzt und Botaniker).
Prag
1570 wurde Arcimboldo nach Prag geschickt, um für Maximilian II. einen großen Festumzug mit mythologischen Themen zu gestalten. Sein Einfallsreichtum als Maler, aber auch bei der Ausrichtung von Umzügen, Krönungsfeiern, prunkvollen Hochzeiten und dergleichen wurde allgemein bewundert. Als Maler, Bühnenbildner, Architekt, Ingenieur und Organisator in einer Person inszenierte er glänzende Feste und höfische Maskeraden, die dazu geeignet waren, die Macht des Kaisers zu verdeutlichen, seinen Ruhm zu vergrößern und das Volk wenigstens für kurze Zeit von seinem alltäglichen Elend abzulenken.
Seit 1575 war er Hofmaler des Kaisers Rudolf II., Maximilians Sohn und Nachfolger. Rudolf II. war ein politisch eher unbedeutender Kaiser, aber ein Freund der Künste und der Wissenschaft, er hielt sich einen bunten Hofstaat von Künstlern, Astronomen, Astrologen und Alchimisten. Arcimboldo hatte für ihn ähnliche Aufgaben zu erfüllen wie zuvor für Maximilian.
Darüber hinaus erfand er hydraulische Maschinen, beschäftigte sich mit einem Museumsprojekt und verfolgte sein Vorhaben, Musik in Farbwerte zu übertragen. Er war nämlich davon überzeugt, dass Malerei und Musik denselben Gesetzen gehorchen, und versuchte daher, eine wissenschaftliche Theorie zu entwickeln, wonach eine feste Beziehung zwischen harmonischen Proportionen von Tönen und Halbtönen einerseits und Farbnuancen andererseits bestünde.
Das „Selbstporträt“ (Národní galerie v Praze, Prag), auf dem sich Arcimboldo frontal dargestellt, zeigt eine vornehme Erscheinung in elegant gestreckten Konturen und im melancholischen Ausdruck, der zum düsteren und „aristokratischen“ Beruf des Künstlers passt.43
Arcimboldo in der Druckgrafik
Ein Jahreszeiten–Zyklus Arcimboldos, bestehend aus „Frühling“ und „Sommer“ sowie „Herbst“ und „Winter“ (Amsterdam, Rijksmuseum), wurde von einem anonymen Künstler in der Technik der Radierung realisiert. Die Büsten sind im Profil wiedergegeben und paarweise zueinander angeordnet. Tatsächlich erinnern die Profilköpfe in ihrer Anordnung an die Grotesken Leonardos. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es die Frage, wann diese Radierungen entstanden sein könnten. Handelt es sich bei diesen einfacheren Kompositköpfen um Werke einer früheren Phase von Arcimboldo, vielleicht noch aus der Mailänder Zeit44 oder sind sie um 158045 zu datieren? Wie die Frage beantwortet wird, hängt von der Rekonstruktion der chronologischen Entwicklung der zusammengesetzten Köpfe Arcimboldos ab. Wer an eine klare Entwicklung – von einer expliziteren, additiven und parataktischen Wiedergabe jedes Details hin zu einer zunehmenden Verschmelzung der einzelnen Objekte und ihrer Unterordnung unter ein einheitliches Ganzes – glaubt, wird sie früh datieren.46
Rückkehr nach Mailand
Erst 1587 erlaubte Kaiser Rudolf II. Arcimboldo die Rückkehr in seine Heimatstadt Mailand. Zuvor hatte Rudolf II. seine Ernennung in den erblichen Adelsstand bestätigt und ihn mit einem Wappenschild geehrt; 1592 wurde ihm der nicht erbliche Titel eines Hofpfalzgrafen verliehen. Nachdem Arcimboldo Prag verlassen hatte und nach Mailand zurückgekehrt war, schuf er seine raffiniertesten und poetischsten Köpfe für Kaiser Rudolf.
Selbstbildnis
Nach Mailand zurückgekehrt, porträtierte sich der Künstler selbst (1587, Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, Genua). Er stellte seinen Kopf aus überlappenden Rollen und Papierblättern zusammen. Auf dem Kragen der Figur ist die Jahreszahl „1587“ geschrieben, während die zwischen den Falten seiner Stirn versteckte Altersangabe „61“ den Witz veranschaulicht, der seine gemalten Erfindungen berühmt machte. Es wurde vermutet, dass Arcimboldo die Schriftrollen und Blätter absichtlich leer ließ, um mit lobenden Worten auf seinen Ruhm gefüllt zu werden, beschäftigte sich der Künstler doch während seiner letzten Lebensjahr sehr bewusst und gezielt mit seinem Nachruhm.47
Papier ist das Medium zur Übermittlung der Zeichenkunst – ein Symbol für inventione, die künstlerische Kreativität – und von Gedichten. Es gibt Gedichte über seine Kunstwerke, die mit „G.A.“ signiert sind. Das lässt den Schluss zu, dass Arcimboldo seinen Wunsch zum Ausdruck bringen wollte, sowohl als Dichter als auch als Philosoph angesehen zu werden.48 Dieses Selbstporträt kann daher als eine Art „Logo“ oder „Unternehmen“ betrachtet werden. Arcimboldos komplexe Künstlerpersönlichkeit baut auf Eigenschaften wie Erfindungsreichtum, Humor, philosophischem Scharfsinn und vor allem einer Liebe zum Paradoxen auf.49
Flora
Der Künstler schickte dem Kaiser zunächst die Göttin „Flora“, eine weibliche Büste aus Blumen.
Vertumnus
Nach der „Flora“ vollendete Arcimboldo eine Hommage an Kaiser Rudolf II., verkleidet als antiker Gott „Vertumnus“ (um 1590, Bålsta, Schloss Skokloster), Gott der Veränderung, der Jahreszeiten und der Landwirtschaft.50 Das Bild ist eine Allegorie auf die Kontinuität einer guten Regierung, als Bewahrer des Wohlstandes nach den Kriegen gegen die Osmanen, wobei dem Herrscher auch Macht über das Pflanzenreich zugesprochen wird. Die Büste ist aus verschiedenen Obst-, Gemüse- und Getreidesorten sowie Blüten zusammensetzt. Auch die für Rudolf typischen Erkennungsmerkmale – pralle Backen (Apfel, Pfirsich), Tränensäcke (Birnen) und Bart (Nüsse, Kastanien, Hirserispen als Hängebacken oder Backenbart?) – werden berücksichtigt.51
Zusammen mit dem Gemälde schickte Arcimboldo ein Büchlein mit einer Sammlung von Lobliedern auf die beiden Werke, die von seinen Freunden Borgogni, Gherardini, Comanini und vielen anderen, darunter ihm selbst, verfasst worden waren. Comaninis Madrigal, das der „Flora“ gewidmet ist, spielt mit dem Wechsel der Worte „Flora“ und „fiori [Blumen]“ und illustriert damit das künstlerische Prinzip, das Arcimboldo bei seinen zusammengesetzten Köpfen anwendet, nämlich das Paradoxon der Koexistenz von Einheit und Vielfalt52: Man kann den ganzen Kopf als eine Einheit betrachten oder sich auf die zahlreichen unterschiedlichen Objekte konzentrieren, aus denen er sich zusammensetzt. Lomazzos Thesen über die verschiedenen Standpunkte, die der Betrachter einzunehmen hat, werden in diesem Zusammenhang nachhaltige Konsequenzen für den kunsttheoretischen Diskurs über die Malerei haben.53 Dem Kaiser dürfte das Bild äußerst gut gefallen haben, denn er belohnte Arcimboldo 1592 mit dem Titel eines Pfalzgrafen.
Kopf mit den vier Jahreszeiten
Der „Kopf mit den vier Jahreszeiten“ (Washington D.C., National Gallery of Art, Paul Mellon Fund) ist eines der letzten Werke Giuseppe Arcimboldos. Er schenkte es seinem Freund Comanini.54 Der kahle Baumstamm stellt den Winter dar, der nichts hervorbringt, sich aber an den Gaben der anderen Jahreszeiten erfreut: den Blumen im Frühling, den Kirschen, dem Weizen und den Pflaumen im Sommer, den Äpfeln und Trauben im Herbst. Der Name des Künstlers, der unter der geschälten Rinde eines Astes zwischen den Äpfeln auf das Holz geschrieben ist, lässt vermuten, dass es sich bei dem Gemälde um ein verstecktes Selbstporträt handeln könnte.55
Kopf mit den vier Jahreszeiten
Der „Kopf mit den vier Jahreszeiten“ (Washington D.C., National Gallery of Art, Paul Mellon Fund) ist eines der letzten Werke Giuseppe Arcimboldos. Er schenkte es seinem Freund Comanini.56 Der kahle Baumstamm stellt den Winter dar, der nichts hervorbringt, sich aber an den Gaben der anderen Jahreszeiten erfreut: den Blumen im Frühling, den Kirschen, dem Weizen und den Pflaumen im Sommer, den Äpfeln und Trauben im Herbst. Der Name des Künstlers, der unter der geschälten Rinde eines Astes zwischen den Äpfeln auf das Holz geschrieben ist, lässt vermuten, dass es sich bei dem Gemälde um ein verstecktes Selbstporträt handeln könnte.57
Arcimboldos Ruhm
In Mailand berichtete Giuseppe Arcimboldo Historikern, Schriftstellern und Dichtern von den großen Erfolgen, die er am kaiserlichen Hof erzielt hatte. Vor allem der Künstler und Kunsttheoretiker Giovanni Paolo Lomazzo58, der Mailänder Historiker Paolo Morigia59 und der Humanist Gregorio Comanini60 gehörten zu seinen bevorzugten Panegyrikern. Arcimboldo war sich offensichtlich der Tatsache bewusst, dass Worte mehr Ruhm verschaffen konnten als Kunstwerke, insbesondere im Ausland. Diesen drei Männern und ihren Schriften verdanken wir alles, was wir über Arcimboldos Leben und Werk wissen.61 In Morigias „La nobiltà di Milano“ (1595) kann man lesen:
„Alles, was ich bisher über das Haus Arcimbolda geschrieben habe, habe ich von Signor Giuseppe Arcimboldo erhalten, einem Herrn des Glaubens und der Integrität des Lebens.“62
In seinem Malereitraktat (1584) beschreibt Lomazzo die „teste composte“ Arcimboldos bewusst als perfekte Dekoration für Gasthäuser, Tavernen und andere „quecksilbrige“ Orte, während er sie in seiner „Idea del tempio della pittura“ (1590) als für Herrscher und Kaiser geeignete Werke rühmte.63 Für diese überraschende Unstimmigkeit gibt es mehrere mögliche Ursachen: So waren etwa Künstler während der Amtszeit von Karl Borromäus gezwungen, sich an strenge Anstandsregeln zu halten und Werke oder Gemälde zu verhüllen, die als „gefährdet“ galten. Kunst sollte ausschließlich unter dem Gesichtspunkt ihres Nutzens für den gläubigen Christen beurteilt werden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Kardinal Paleotti in seinem 1582 veröffentlichten „Discorso intorno alle immagini sacre e profane“ bestimmte Werke als „lächerliche Gemälde“ bezeichnete und ihnen eine dämonische und grenzüberschreitende Kraft zuschrieb, die unterdrückt werden müsse.64 Überzeugender erscheint jedoch die Annahme, dass es Arcimboldo dank seines Einfallsreichtums gelang, seine aus dem „niederen Genre“ komponierten Köpfe zu Lobgesängen auf den Kaiser zu erheben.
Tod
Arcimboldo starb am 11. Juli 1593 in Mailand.
Seine Bild-Erfindungen beeindruckten manchen Künstler des Surrealismus, darunter Salvador Dalí, der in seinem Gesicht der Mae West als Appartement (Gouache, Chicago) und Spanien (Öl, Rotterdam) Anregungen Arcimboldos aufnahm und weiterverarbeitete.
Der Asteroid (6556) Arcimboldo wurde nach ihm benannt.
Beiträge zu Arcimboldo
- M. Staudinger, Sources on Arcimboldo at the Habsburg Court, in: Arcimboldo 2007–2008, S. 303–309; Leydi, in: Arcimboldo 2007-2008, S. 297–302.
- Piero Brocardo, Giuseppe Arcimboldo, Selbstbildnis, in: Arcimboldo (1526–1593), hg. v. Sylvia Ferino-Pagden (Ausst.-Kat. Kunsthistorisches Museum, Wien), Wien 2008, S. 32.
- Morigia 1592, S. 556.
- M. Staudinger, in: Arcimboldo 2007–2008, S. 306, Nr. 21; S. 308, Nr. 34.
- S. Leydi, in: Arcimboldo 2007–2008, S. 37–39.
- M. T. Fiorio, Da Carlo V a Carlo Borromeo: il percorso del manierismo Lombardo, in: M. T. Fiorio, V. Terraroli (Hg.), Lombardia Manierista Arti e architettura 1535–1600, Mailand 2009, S. 9–67.
- S. Leydi, in: Arcimboldo 2007–2008, S. 37–52; S. Leydi, in: Arcimboldo 2007–2008, S. 297–302.
- Pittori della realtà. Le ragioni di una rivoluzione. Da Foppa e Leonardo a Caravaggio e Cerruti, hg. v. M. Gregori und A. Beyer (Ausst.-Kat. Cremona; New York), Cremona 2004; Fiorio 2009, S. 9–67.
- Siehe: Leonardo da Vinci 1452–1519, hg. v. M. T. Fiorio und P. C. Marani (Ausst.-Kat. Mailand) Mailand 2015.
- G. P. Lomazzo, Trattato, 1584, Libro VI, cap. XXXIII, hg. v. R. P. Ciardi 1973/74, Bd. II, S. 315.
- Naturstudien aus dem Besitz von Kaiser Rudolf II., Prag 1500, S. 136 (Österreichische Nationalbibliothek, Handschrift): mit 170 Blätter, gefällt mit Zeichnungen von Joris Hoefnagel, Giuseppe Arcimboldo, et alii., S. 24
- Giorgio Vasari, Le vite… , hg. v. G. Milanesi, Florenz 1879, Bd. IV, S. 24.
- P. Venturelli, Leonardo da Vinci e le arti preziose Milano tra XV e XVI secolo, Venedig 2002; P. Venturelli, Dalla bella Valentina a Leonardo da Vinci. Smalti e oreficeria tra Visconti e Sforza, in: Artigianato e lusso. Manufatture preziose alle origini di Made in Italy, Mailand 2013; P. Venturelli, Splendidissime gioie. Cammei, cristalli e pietre dure milanesi per le Corti d’Europa (XV-XVII secc.), Florenz 2013.
- Die Mailänder Werkstätten, die von Künstlern wie Giulio Taverna, Francesco Tortorino, Serracchi, Gasparo und Girolamo Miseroni, Annibale Fontana und anderen geleitet wurden, schufen Produkte von höchster Qualität unter Verwendung von Edelsteinen, Bergkristallen, Lapislazuli, grünem Quarz und eleganten Gold- und Emaillefassungen.
- S. Leydi, in: Arcimboldo 2007–2008, S. 47–52, 308–309; Sylvia Ferino-Pagden, “…e massime con le invenzioni e capricci, ne’ quale egli è unico al mondo”: il rebus Arcimboldo, in: Arcimboldo 2011, S. 153–219; 211–212; Fußnote 106-109.
- B. W. Mejier, “L’Arte non deve schernire”: sul comico e sul grottesco al Nord, in: Rabisch 1998, S. 69–76; Porzio 2008, S. 80–82.
- 13
- 14
- 15
- 3
- 4
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 17
- 19
- 20
- 21
- Francesco Porzio, Arcimboldo. Le Stagioni »milanesi« e l’origine dell’invenzione, in: AK Mailand 2011, S. 221–253.
- Ferino-Pagden, Giuseppe Arcimboldo, in: Arcimboldo (Ausst.-Kat. Rom 2017), Rom 2017, S. 22.
- Karl Rudolf, Arcimboldo im kulinarischen Wissensraum. Die Kunstkammer Kaiser Ferdinands I. (1503–1564), in: Sabine Haag, Franz Kirchweger, Paulus Rainer (Hg.), Das Haus Habsburg und die Welt der fürstlichen Kunstkammern im 16. und 17. Jahrhundert (Schriften des Kunsthistorischen Museums 15), Wien 2015, S. 133–165.
- María Teresa Santamaría & Pedro José Salvador Palomo, Valencia y los agrios: del jardin de los cinco sentidos al huerto productivo-burgués, in: Alessandro Tagliolini & Margherita Azzi Visentini (Hg.), Il giardino delle Esperidi. Gli agrumi nella storia, nella letteratura e nell’arte. Atti del V Colloquio Internazionale Cetro Studi Giardini Storici e Contemporanei Pietrasanta 13–14 ottobre 1995, Florenz 1996, S. 141.
- Hilda Lietzmann, Ferdinands I. Verdienste um die Gartenkunst, in: AK Wien 2003, S. 259–263; Hilda Lietzmann, Irdische Paradiese: Beispiele höfischer Gartenkunst der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts (Kunstwissenschaftliche Studien 141), München 2007; Karl Schütz, Kunst und Kultur am Hof Kaiser Maximilians II., in: AK Paris & Wien 2007/08, S. 73–79.
- DaCosta Kaufmann.
- Provenienz: von Kaiser Maximilian 1566 in Auftrag gegeben; 1872 von Kaiser Franz Joseph I. (aus dem Depot des Kunsthistorischen Museums) als Geschenk an die Sammlungen des Joanneums (Graz); seit den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts in Privatbesitz; seit 2005 als Dauerleihgabe in den Fürstlichen Sammlungen; 2015 erworben durch Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein.
- Thomas DaCosta Kaufmann, Arcimboldo’s Imperial Allegories: G.B. Fonteo and the Interpretation of Arcimboldo’s Painting, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 39, 1976, S. 275–296.
- Dr. Neefe hielt sich 1563/64 in Wien auf.
- Karl Rudolf, Arcimboldo im kulinarischen Wissensraum. Die Kunstkammer Kaiser Ferdinands I. (1503–1564), in: Sabine Haag, Franz Kirchweger, Paulus Rainer (Hg.), Das Haus Habsburg und die Welt der fürstlichen Kunstkammern im 16. und 17. Jahrhundert (Schriften des Kunsthistorischen Museums 15), Wien 2015, S. 133–165.
- Porzio 2011.
- Siehe: Wencke Deiters, Giuseppe Arcimboldo, Der Frühling, Der Sommer, Der Winter, in: Arcimboldo - Bruegel - Bassano (Ausst.-Kat. KHM, Wien 2025), Wien 2025, S. 183; Karl Rudolf geht auch davon aus, dass Neefe den Wiener Jahreszeiten-Zyklus sah. Siehe: Rudolf 2015, 134f.
- 12
- 38
- Arcimboldo – Bassano – Bruegel. Die Zeiten der Natur, hg. v. Francesca Del Torre Scheuch (Ausst.-Kat. Kunsthistorisches Museum, Wien, 11.3.–29.6.2025) Wien 2025, S. 163.
- 39
- Siehe u.a. T. DaCosta Kaufmann, Arcimboldo. Visual Jokes, Natural History, and Still-Life Painting, Chicago/London 2009.
- A. Beyer, Ruhmesblätter. Giuseppe Arcimboldos Selbstporträt von 1587 als memoria cartacea, in: Sebastian Egenhofer et al. (Hg.), Was ist ein Bild? Antworten in Bildern, München 2012, S. 287–289.
- Sylvia Ferino-Pagden, Arcimboldo e il paradosso “mise en abyme”, in: Arcimboldo, hg. v. Sylvia Ferino-Pagden (Ausst.-Kat. Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, Palazzo Barberini, Rom, 20.10.2017–11.2.2018), Rom 2017, S. 14–23, hier S. 15.
- Wencke Deiters, Giuseppe Arcimboldo (1526–1593), Vertumnus, in: KHM 2025, S. 186–187.
- Ebenda, S. 187.
- 44
- G. Berra, Allegoria e mitologia nella pittura dell’Arcimboldi: la “Flora” e il “Vertunno” nei versi di un libretto sconosciuto di rime, in: Acme, 41, 2, 1988, S. 11–39.
- Comanini (1591) 1962, S. 268–269.
- Sylvia Ferino-Pagden, in: Arcimboldo 2007–2008, S. 144–146, Nr. IV.15.
- Comanini (1591) 1962, S. 268–269.
- Sylvia Ferino-Pagden, in: Arcimboldo 2007–2008, S. 144–146, Nr. IV.15.
- G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte de la pittura... Ne’ quali si contiene tutta la Theorica, & la prattica d’essa pittura, Mailand 1584; G. P. Lomazzo, Idea del tempio della Pittura di Gio. Paolo Lomazzo pittore. Nella quale egli discorre dell’origine, & fondamento delle cose contenute nel suo trattato dell’Arte della Pittura. All’Invittiss. et Potentiss. Signore il Rè Don Filippo d’Austria & c., Mailand 1590, in: Gian Paolo Lomazzo. Scritti sulle arti, a cura di R.P. Ciardi, 2 Bde., Florenz 1973/74, I, S. 241–373.
- Paolo Morigia, Historia dell’antichità di Milano, divisa in quattro libri…, Nella quale si racconta brevemente…, Venedig 1592; Paolo Morigia, La nobiltà di Milano…, Mailand 1595.
- Gregorio Comanini, Il Figino, overo del fine della pittvra. Dialogo del Rever. Padre D. Gregorio Comanini Canonico Regolare Lateranense. Ove quistionandosi, se’ l fine della pittura sia l’utile, ouero il diletto, si tratta dell’uso di quella nel Christianesimo. Et si mostra, qual sia imitator più perfetto, & che più diletti, il Pittore, overo il Poeta, Mantua 1591, in: P. Barocchi (Hg.), Trattati d’arte del Cinquecento fra Manierismo e Controriforma, Bari 1962, III, S. 237–379; Gregorio Comanini, Il Figino, overo del fine della pittvra. Dialogo..., Mantua 1591, in: A. Doyle-Anderson und Giancarlo Maiorino (Hg.), The Figino or On the Purpose of Painting. Art Theory in the Late Renaissance, Toronto / London 2001.
- A. Beyer, “… il gran pittore Giuseppe Arcimboldi”. On the Construction of Arcimboldo’s Fame, in: Arcimboldo 1526–1593, hg. v. Sylvia Ferino-Pagden (Ausst.-Kat. Paris; Wien), Wien 2007, S. 25–31.
- 7
- G. P. Lomazzo, Idea (1590), hg. v. R. P. Ciardi, Florenz 1973/74, Bd. I, S. 361–363.
- Porzio 2008, S. 49–72; G. Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre et profane diviso in 5 libri..., Bologna 1582.