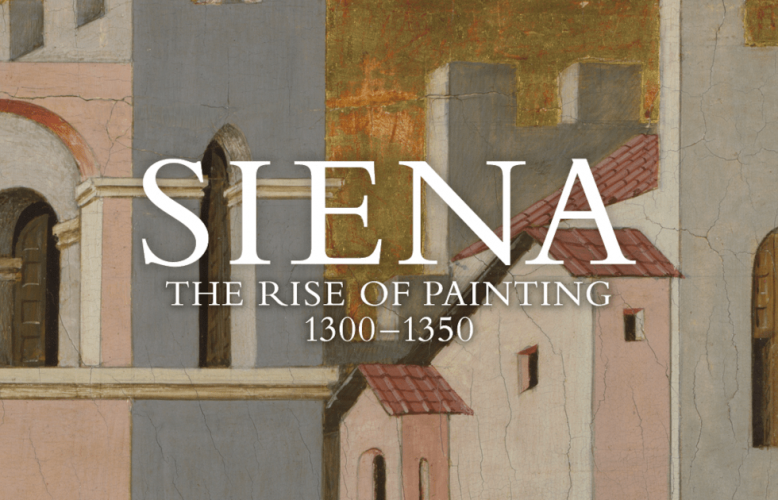Michael Pacher-Werkstatt, Hl. Barbara Spätgotischer Meister mit europäischer Bedeutung

Michael Pacher-Werkstatt, Hl. Barbara, Detail, um 1480/1490, Zirbenholz, 54,5 x 41 cm (Belvedere, Wien, Inv.-Nr. 4848)
Michael Pacher (um 1435–1498) lebte und arbeitete in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Bruneck im heutigen Südtirol. Er ist einer der Hauptmeister der Spätgotik von gesamteuropäischer Bedeutung und wird in der Generation vor Albrecht Dürer mit Martin Schongauer und Nicolaus Gerhaert van Leyden verglichen (→ Gotik).1 Ab 1459 ist Michael Pacher als Meister nachzuweisen. Mit den Flügelaltären in St. Wolfang am Wolfgangsee (elf Meter hoch: 55 Skulpturen, 70 m² Tafelmalerei, 100 m Gesprängeofeiler) und dem sich heute in der Alten Pinakothek München befindlichen „Kirchenväteraltar“ schuf er hochbedeutende Werke der Kirchenausstattung. Gleichzeitig rezipierte er Wandmalerei in Oberitalien – beispielsweise von Andrea Mantegna – und führte das Verhältnis von Körpern und Raum auf eine neue Ebene. 1495 war Michael Pacher von seiner Heimatstat Bruneck nach Salzburg übersiedelt, um dort die Aufstellung und Vollendung des Hochaltars der ehemaligen Salzburger Stadtpfarrkirche (heute: Franziskanerkirche) voranzutreiben. In Salzburg, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte, ist er im Sommer 1498 gestorben.
Die „Hl. Barbara“ der Pacher-Werkstatt aus der Gotik-Sammlung des Belvedere ist auf goldenem Grund wiedergegeben, was auf eine Positionierung des Tafelbildes an einer Innenseite eines Flügelaltars hinweist. Die hl. Barbara wird bildfüllen wiedergegeben. Sie hat ihr Marterwerkzeug – das Schwert, mit dem sie der Legenda aura zufolge von ihrem Vater enthauptet wurde – in der Linken. Mit der Rechten präsentiert sie einen gotischen Turm. Auch hier ist die Lebende um die jungfräuliche Märtyrerin aussagekräftig: Ihr Vater hat sie in einen Turm sperren lassen, um sie vor der Bekehrung zum Christentum zu hindern. Die Heiligen hat sich dennoch dem christlichen Glauben zugewandt und als Zeichen dafür ein drittes Fenster einschlagen lassen. Die nunmehrigen drei Fenster symbolisieren die Dreifaltigkeit, auf einem Mauervorsprung balanciert noch ein Abendmahlskelch mit einer schwebenden Hostie.
- Michael Pacher-Werkstatt, Hl. Barbara, Detail, um 1480/1490, Zirbenholz, 54,5 x 41 cm (Belvedere, Wien, Inv.-Nr. 4848)
Gotische Flügelaltäre für den süddeutschen Raum
Da Michael Pacher mit seiner Werkstatt auf die Ausführung hochkomplexer Flügelaltäre spezialisiert war, haben sich in Südtirol nur weniger seiner Werke erhalten. Die wichtigsten Arbeiten sind der nicht vollständig erhaltene Altar von Gries bei Bozen und die „Madonna von St. Lorenzen“ (Bayerisches Nationalmuseum, München). Der einst berühmte Michael-Altar der Bozener Pfarrkirche ist schon seit dem 17. Jahrhundert verloren. Tafeln des St. Lorenzener Altars wurden im 19. Jahrhundert verkauft und befinden sich heute im Belvedere in Wien. 1812 erwarb etwa München den monumentalen Kirchenväter-Altar aus Neustift.
Das monumentalste und noch orignal erhaltene Hauptwerk Michael Pachers ist der sogenannte Pacher-Altar, d.h. der Hochaltar in der Walfahrtskirche von St. Wolfgang (Oberösterreich). Zwischen 1471 und 1481 arbeitete Pacher mit seiner Werkstatt daran in Bruneck. Der Wandelaltar verfügt über einen skulptural gestalteten Schrein mit der „Marienkrönung“, der von zwei Flügeln verdeckt wird. 71 geschnitzte und gefasste Skulpturen sowie 24 einzelne Gemälde erzählen die Marienlegende. Auf der Werktagsseite zeigt der 10,88 Meter hohen Hauptaltar der Wallfahrtskirche die Legende des hl. Wolfgang. Sonntags folgt die Lebensgeschichte Jesu, und nur an Feiertagen ist die „Marienkrönung“ mit weiteren Darstellungen aus den Leben von Christus und Maria zu sehen: Geburt, Darbringung, Beschneidung und Marientod. Die beiden Schreinwächterfiguren - der hl. Georg (rechts) und der hl. Florian (links) - sind nur im geschlossenen Zustand zu sehen. Darüber befinden sich zwei weibliche Heilige: Katharina und Margareta.
Michael Pacher: bedeutende Werke
- Thomas Becket-Tafeln (Graz, Joanneum)
- Laurentiusaltar aus der Pfarrkirche von St. Lorenzen im Pustertal, Mitte 1460er Jahre (Bruneck; München, Alte Pinakothek; Belvedere, Wien)
- Papst Sixtus II. nimmt Abschied vom hl. Laurentius (Belvedere)
- Der hl. Laurentius vor Kaiser Decius
- Wiltener Predellenflügel, um 1465 – dürften ursprünglich zum Laurentiusaltar gehört haben (Belvedere, Wien; Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
- Marienkrönungsaltar, 1471–1473
- Kirchenväteraltar für das Kloster Neustift bei Brixen, 1475–1483 (München, Alte Pinakothek)
- Michaels-Altar, 1480–1484 (ehemals Bozen)
- Michael, um 1465 (Bayerisches Nationalmuseum)
- St.-Wolfganger Altar, 1471 (Vertrag), um 1475–1481 (St. Wolfgang, Pfarrkirche)
- Michael Pacher Werkstatt, Thronende Madonna zwischen dem hl. Michael und einem hl. Bischof (Martin?), um 1480/90 (London, National Gallery)
- Fragemente vom Hochaltar der Stadtpfarrkirche Salzburg, vor 1498 (Belvedere, Wien)
- Joseph wird in den Brunnen geworfen (Belvedere, Wien)
- Mariengeburt (Privatbesitz, Wien)
- Geißelung Christi (Belvedere, Wien)
- Vermählung Mariens (Belvedere, Wien)
- Das Kultbild, eine Madonna mit Kind, wurde in den von Johann Bernhard Fischer von Erlach konzipierten Hochaltar (1708/09) übernommen. Der Kopf des Kindes hierbei zu einem Putto umfunktioniert.
Michael Pacher-Werkstatt, Hl. Barbara: Bild
- Michael Pacher-Werkstatt, Hl. Barbara, um 1480/1490, Zirbenholz, 54,5 x 41 cm (Belvedere, Wien, Inv.-Nr. 4848)