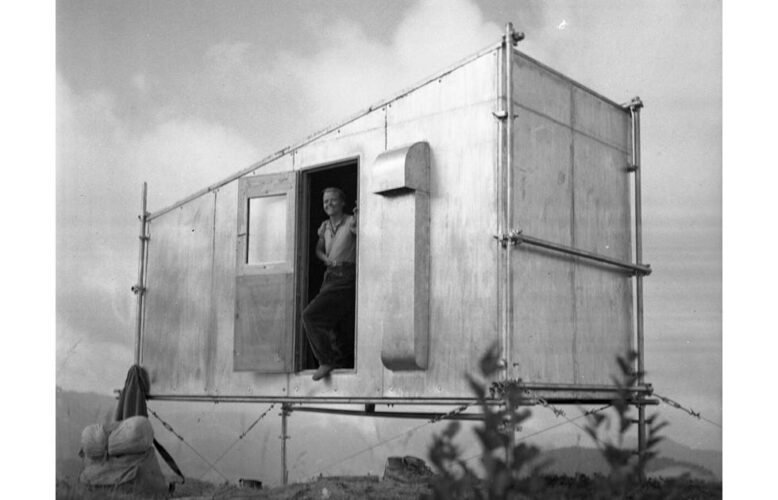Hamburg | Bucerius Kunst Forum: Malerinnen und ihre Familien Geniale Malerinnen vom 16. bis 18. Jahrhundert | 2023/24

Catharina van Hemessen, Selbstbildnis an der Staffelei, 1548 (Kunstmuseum Basel, Schenkung der Prof. J.J. Bachofen-Burckhardt-Stiftung 2015)
Die Ausstellung verfolgt den Werdegang herausragender Künstlerinnen aus drei Jahrhunderten. Erstmals wird der familiäre Kontext, in dem die Künstlerinnen ihre Karriere entwickelten, thematisiert und durch die Gegenüberstellung mit Werken ihrer Väter, Brüder, Ehemänner und Malerkollegen sichtbar gemacht. Außerordentlich erfolgreich waren Künstlerinnen in jeglicher familiären Konstellation: Sie wurden Hofmalerinnen, Lehrende, Unternehmerinnen, aber auch Verlegerinnen und mit höchsten Auszeichnungen versehen.
Geniale Frauen.
Malerei vom 16. bis 18. Jahrhundert
Deutschland | Hamburg:
Bucerius Kunst Forum
14.10.2023 — 28.1.2024
Geniale Frauen. Malerei vom 16. bis 18. Jahrhundert
In Kooperation mit dem Kunstmuseum Basel zeigt das Bucerius Kunst Forum im Herbst 2023 eine sozialkritisch angelegte Schau zu Malerinnen aus der Renaissance, dem Barock und dem Klassizismus. Dabei wählen die Kurator:innen einen interessanten Zugang, indem sie die Künstlerinnen in ihrem sozialen und künstlerischen Umfeld zeigen. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen über deren gesellschaftliche Möglichkeiten, ihre (künstlerische) Herkunft und Durchsetzungsfreudigkeit. Die Genialität dieser Frauen bezieht sich also nicht nur auf ihr Talent und ihre neuartigen künstlerischen Lösungen, sondern auch auf ihren Umgang mit der Gesellschaft.
Eine Künstlerkarriere einzuschlagen, war für Frauen in der Frühen Neuzeit nicht unmöglich, jedoch nicht vorgesehen und unterlag deshalb stets besonderen Herausforderungen. Für eine freie Berufsausübung war die Zugehörigkeit zu einer Zunft notwendig, diese war den Frauen jedoch je nach Region verwehrt, oder andernfalls mit Hürden und Kosten versehen. Auffallend viele Künstlerinnen dieser Zeit stammten daher aus Künstlerfamilien oder heirateten in solche ein. Sie arbeiteten ihren Vätern, Brüdern und Ehemännern zu und waren oftmals im Verborgenen tätig. An Höfen sah die Situation anders aus: Frauen konnten offen als Künstlerinnen tätig sein, da andere Regeln herrschten und man aufgeschlossen gegenüber der künstlerischen Leistung war, unabhängig von Herkunft und Geschlecht. Künstlerinnen, die sich entgegen den gesellschaftlichen Normen durchgesetzt hatten, fielen den Zeitgenossen auf und ihnen wurde Anerkennung gezollt. Durch den überwiegend männlichen Blick, der in der Kunstwissenschaft bis ins 20. Jahrhundert vorherrschte, gerieten ihre Leistungen jedoch lange Zeit in Vergessenheit.
Töchter, Brüder und Väter
Die Ausstellung startet fulminant mit dem Selbstporträt von Katharina van Hemessen, dem frühesten Selbstbildnis, auf dem sich ein Maler oder eine Malerin arbeitend an der Staffelei darstellt. Katharina van Hemessen erhielt ihre Ausbildung in der Werkstatt ihres Vaters Jan Sanders van Hemessen. Auch er malte Bildnisse, doch übertraf ihn seine Tochter auf diesem Gebiet.
Katharina van Hemessens Leben und Werk ist Teil des ersten Kapitels Töchter, Brüder und Väter wie auch das von Tintoretta, der Tochter des venezianischen Künstlers Tintoretto. Die Ausstellung gliedert sich darüber hinaus in folgende Kapitel: Bewusst ledig, Bis zur Ehe, Malen mit Familie, Grafikerinnen, Künstlerinnen am Hof und Künstlerinnen in den Institutionen.
Für viele Malerinnen geriet nach der Eheschließung das produktive künstlerische Schaffen in den Hintergrund, wie u.a. auch die Biografie Judith Leysters zeigt. Sie hatten sich um die familiären Pflichten zu kümmern oder arbeiteten anonym in der Werkstatt ihres Mannes. Andere Künstlerinnen setzten ihr künstlerisches Schaffen auch mit Familie fort. Lavinia Fontana war in der Spätrenaissance eine sehr bekannte Malerin und eine der ersten Frauen, die sich in diesem Beruf etablierte. Ihr Erfolg war so groß, dass ihr Ehemann Giovanni Paolo Zappi, ebenfalls Maler, zu ihren Gunsten seine Karriere aufgab, um sich um die Familie zu kümmern. Demgegenüber verzichteten einige Künstlerinnen offenbar bewusst auf eine Heirat oder trennten sich von ihren Ehemännern, um ihrer Profession nachgehen zu können. So auch Maria van Oosterwijck, eine der bedeutendsten Stilllebenmalerinnen der nördlichen Niederlande, oder die Blumenmalerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian.
In der Druckgrafik fassten einige Künstlerinnen Fuß: Hier sticht im 18. Jahrhundert Maria Katharina Prestel hervor, die sich zusammen mit ihrem Mann Johann Gottlieb Prestel auf die druckgrafische Darstellung von Zeichnungen und Gemälden spezialisiert hatte.
Hofmalerinnen
Mehrere Künstlerinnen brachten es bis zur Hofmalerin, darunter Sofonisba Anguissola, die den spanischen König Philipp II. und seine Familie in zahlreichen Porträts festhielt. Eine Ausnahme bildete in jener Zeit Rachel Ruysch, denn sie und ihr Ehemann waren beide in ihrem Beruf als Maler:in erfolgreich. Beide waren für den Düsseldorfer Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz-Neuburg tätig.
Künstlerinnen in den Institutionen
Die Ausstellung schließt mit dem Kapitel Künstlerinnen in den Institutionen, das Werke bekannter Künstlerinnen wie Elisabetta Sirani, Angelika Kauffmann und Dorothea Therbusch präsentiert. Elisabetta Sirani übernahm die Leitung der Werkstatt ihres Vaters, in der sie ausgebildet wurde. Aufgrund ihres ausgezeichneten Rufs wurde sie in die Accademia di San Luca in Rom aufgenommen. Darüber hinaus gründete sie in Bologna eine Malschule ausschließlich für Frauen, um sie künstlerisch auszubilden.
Zum ersten Mal werden Werke der Künstlerinnen mit denen ihrer männlichen Kollegen so pointiert gegenübergestellt. Dabei werden sowohl formale als auch stilistische Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich. Die wissenschaftliche Arbeit und der Austausch mit internationalen Expert:innen hat darüber hinaus einige neue Erkenntnisse zu Tage gebracht.
Ausgestellte Künstlerinnen
Die Ausstellung präsentiert rund 100 Werke u.a. von Sofonisba Anguissola | Mary Beale | Gesina ter Borch | Ginevra Cantofoli | Fede Galizia | Giovanna Garzoni | Artemisia Gentileschi | Catharina van Hemessen | Lavinia Fontana | Angelika Kauffmann | Giulia Lama | Judith Leyster | Maria Sibylla Merian | Louise Moillon | Maria van Oosterwijck | Magdalena van de Passe | Clara Peeters | Maria Katharina Prestel | Marietta Robusti (Tintoretta) | Rachel Ruysch | Diana Scultori | Elisabetta Sirani | Anna Dorothea Therbusch | Catharina Treu | Anne Vallayer-Coster | Alida Withoos | Michaelina Woutier
Im Anschluss wird die Ausstellung im Kunstmuseum Basel gezeigt → Basel | Kunstmuseum: Geniale Malerinnen vom 16. bis 18. Jahrhundert
Quelle: Bucerius Kunst Forum, Hamburg
Geniale Frauen: Künstlerinnen und ihre Weggefährten: Katalog
mit Beiträgen von B. Brinkmann, K. Dyballa, S. Engel, A. Mensger, R. Müller, S. Salomon, A. Tacke, S. Pisot, I. Wenderholm, S. Werthemann
300 Seiten, 200 Abbildungen in Farben
22,5 x 28 cm, gebunden
ISBN: 978-3-7774-4236-5
Malerinnen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert: Bilder
- Catharina van Hemessen, Selbstbildnis an der Staffelei, 1548 (Kunstmuseum Basel, Schenkung der Prof. J.J. Bachofen-Burckhardt-Stiftung 2015)


![Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit, Rekonstruktion des Boudoir d’une grande vedette [Boudoir für einen großen Star] Weltausstellung, Paris, 1937, MAK Ausstellungsansicht, 2021, Ausführung: Manfred Trummer, Johannes Ranacher, Glaserei Scharl, Johannes Falkeis, Marina Paric, Irina Huller, Tischlerei des MAK, Wien, 2014, MAK Ausstellungshalle © MAK/Georg Mayer](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Josef-Hoffmann.-Fortschritt-durch-Schönheit-Rekonstruktion-des-Boudoir-d’une-grande-vedette-Boudoir-für-einen-großen-Star-Weltausstellung-Paris-1937-MAK-Ausstellungsansicht-2021-778x500.jpg)