Hannah Höch: Biografie Lebenslauf der deutschen Künstlerin der Moderne
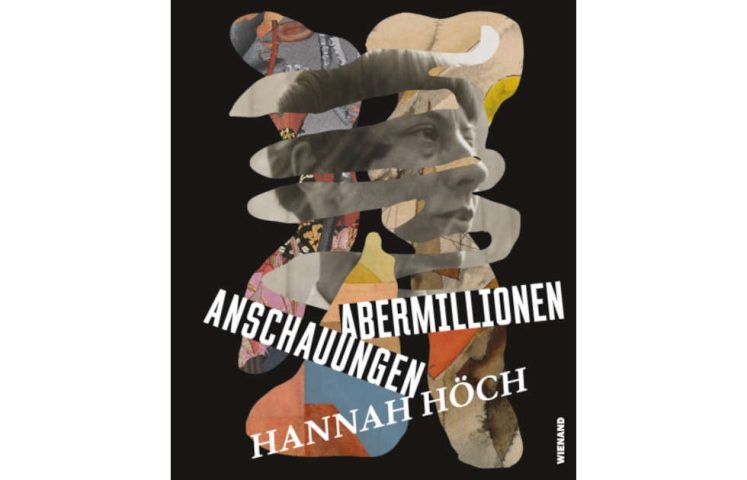
Hannah Höch. Abermillionen Anschauungen im Bröhan Museum, Cover des Katalogs vom Wienand Verlag
Hannah Höch (Gotha 1.11.1889–31.5.1978 Berlin) war eine deutsche Kunstgewerblerin, Pionierin der Fotomontage und Malerin der Moderne (→ Klassische Moderne). Höch war die einzige Frau im Berliner Dadaistenzirkel (→ Dadaismus).
Kindheit
Hannah Höch wurde am 1. November 1889 als Anna Therese Johanne Höch in Gotha (Thüringen) geboren. Ihr Vater war Inspektor der Stuttgarter Versicherungen, die Mutter dem „Schöngeistigen“ zugewandt. Höch wuchs in einem gutbürgerlichen Ambiente auf. Der Vater war Mitglied der Gothaer Freimaurerloge „Ernst zum Compass“ (der Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“, Berlin), ihre Erziehung geprägt von den reformerischen Leitsätzen Friedrich Wilhelm August Fröbels (1782–1852), der zur Förderung der kreativen Anlagen des Kindes Klebebilder oder Baukastenspiele empfahl.1 Erste Klebebilder und Ölgemälde stammen aus dieser Frühzeit um 1904/1907. Seit ihrer Jugend interessierte sie sich für Philosophie.
„Also das war bereits irgendwie vorhanden.“2 (Hannah Höch, 1973)
Ausbildung
Hannah Höch begann ihre Ausbildung 1912 an die Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Charlottenburg. Sie besuchte die Klasse 6 für Glasgestaltung unter Leitung von Harold Bengen. Zu den Unterrichtsschwerpunkten zählten „Flächenkunst, Glasmalerei, Musterzeichnen, Modezeichnen und Stickereientwürfe“, das Naturstudium. Zudem besuchte sie Kurse des Schriftkünstlers Ludwig Sütterlin (1865–1917). Herwarth Walden (1878–1941) gründete die „Sturm“-Galerie (bestand bis 1932), ein Zentrum der Avantgarde-Ausstellungen und des Expressionismus.
Im Jahr 1914 reiste Hannah Höch mit einem Stipendium zur Werkbund-Ausstellung nach Köln. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden Kunstschulen vorübergehend geschlossen. Höch kehrte nach Gotha zurück und arbeitete als Hilfskraft beim Roten Kreuz.
1915 zog wieder Hannah Höch wieder nach Berlin und wechselte in die Klasse Emil Orliks (1870–1932) für Grafik und Buchkunst an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums. Dort war sie vom Sommerquartal 1915 bis zum Winterquartal 1919/20 immatrikuliert; 1916 und 1917 als Freischülerin, ab 1918 als Stipendiatin verzeichnet. Daneben besuchte sie Abendkurse in Kalligrafie und Modellzeichnen sowie die Holzschnittklasse von Oskar Bangemann (1882–nach 1942). Natur- und Aktstudien standen im Vordergrund. Zu ihren Mitschülern gehörte u.a. George Grosz (ab 1913). Orlik vertraute ihr eigene Zeichnungen an, die sie in Holzstich übertrug:
„Als neuestes arbeite ich jetzt ständig etwas für Orlik, Holzschneiden, und erhalte MK. 40,--. Da kann ich wenigstens dabei in der Schule sein.“3
Werke
Frühe Werke
Das Jahr 1915 wurde für die Entwicklung der Kunststudentin äußerst bedeutend. Sie knüpfte erste Kontakte zum „Sturm“-Kreis. Zudem lernte Hannah Höch Raoul Hausmann (1886–1971) und Johannes Baader (1875–1955) sowie Salomo Friedlaender / Mynona (1871–1946) kennen. Eine konfliktreiche Beziehung zu Hausmann begann, die bis 1922 dauerte. Höch beschäftigte sich mit Schriften von Wassily Kandinsky, mit Nietzsche, den Theorien von Salomo Friedlaender.
Ab 1. Januar 1916 arbeitete Hannah Höch zum Broterwerb drei Tage die Woche in der Handarbeitsredaktion des Ullstein Verlages (bis 1926). Sie fertigte Schriftvorlagen, Vignetten, Illustrationen, Entwürfe, Filetmuster und Handarbeitsvorlagen für die Zeitschriften „Die Dame“ und „Die praktische Berlinerin“; ihre Stoff- und Tapetenmusterrapporte sowie Stickmuster erschienen in der „Stickerei- und Spitzen-Rundschau“. Höch schuf Linolschnitte, die später in die Mappe „Miniaturen“ (1964) einflossen.
Hannah Höch und Dada
Der Arzt und Autor Richard Huelsenbeck (1892–1974) brachte Dada 1917 nach Berlin, nachdem die Bewegung als Dada Zürich 1916 im Cabaret Voltaire ihren Anfang genommen hatte. Am 22. Februar 1918 hielt Huelsenbeck im Saal der Berliner Secession die „Erste Dada-Rede in Deutschland“. Die Gründung des Club Dada, ein erster dadaistischer Vortragsabend fand am 12. April statt. Raoul Hausmann dort trug sein Manifest „Das neue Material in der Malerei“ vor, jedenfalls teilweise, denn Tumult brach aus. Hausmann und Höch entdeckten die schöpferischen Potenziale der Fotomontage. Höch publizierte mehrere Artikel in der „Stickerei- und Spitzen-Rundschau“, in denen sie einen engen Zusammenhang der Stickerei mit der Malerei postulierte.
Der Erste Weltkrieg findet durch den Aufstand der Kieler Matrosen und die Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten ein Ende. Der Kaiser trat am 28. November 1918 zurück, und Friedrich Ebert wurde Reichskanzler. Man hoffte auf Frieden und eine neue Gesellschaftsordnung. Am 3. Dezember gründete sich die Novembergruppe mit dem Ziel, „radikale bildende Künstler; Maler, Bildhauer, Architekten“ zu vereinen, „zur Vertretung und Förderung ihrer künstlerischen Interessen“.4 Höch wurde 1919 Mitglied, sie nahm bis 1926 regelmäßig an der „Großen Berliner Kunstausstellung“ teil.
Raoul Hausmann setzte sich 1919 in philosophisch-politischen Essays in den Zeitschriften „Der Einzige“ und „Die Erde“ mit den Geschehnissen auseinander. Höch zeigte abstrakte Aquarelle und Zeichnungen in der „Ersten Berliner Dada-Ausstellung“ im Graphischen Kabinett J. B. Neumann. In diesem Sommer entstand eines ihrer wichtigsten Werke: „Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands“ (Berlin).
Spätestens seit 1919 kannte Hannah Höch Kurt Schwitters und die Gedichte von Hans Arp. Die Künstlerin verfolgte und sammelte eine Fülle von avantgardistischen Zeitschriften. Zwischen Höch und Hausmann kam es zu periodischen Zerwürfnisse. Hausmann belehrte Höch in umfangreichen Notizheften zur Befreiung des Selbst, insbesondere zur weiblichen Befangenheit in patriarchalischen Strukturen.
In der „Ersten Internationalen Dada-Messe“ in der Kunsthandlung Dr. Otto Burchard zeigte Hannah Höch 1920 mehrere Collagen, unter anderem „Collage mit Pfeil“, zwei Dada-Puppen und eine verschollene Dada-Plastik.5
Infolge diverser Auseinandersetzungen mit Hausmann reiste Höch nach Italien, wo sie Kontakt zu den Futuristen aufnahm (→ Futurismus). Insbesondere interessierte sie sich für die Arbeit von Enrico Prampolini, über den sie die Zeitschriften „Atys“ und „noi“ kennenlernte, und Filippo Tommaso Marinetti. Das Visum erhielt sie durch die Vermittlung von Mies van der Rohe.6 In München besuchte Hannah Höch die „Expressionistischen Werkstätten“. Über Kontakte von Hans Hofmann wurden zwei ihrer Dada-Puppen und nach den Entwürfen von Raoul Hausmann gestickte Kissen auf der Ausstellung „Junge Kunst Deutschlands“ in Chicago gezeigt. Höch besuchte Soireen bei dem rumänisch-stämmigen Maler Arthur Segal (1875–1944) und später auch bei dem Neurologen und Psychoanalytiker Ernst Simmel (1882–1947). Sie beschäftigte sich ausgiebig mit Psychologie und Psychoanalyse. Eine Reihe von abstrakt-konstruktiven Werken entstanden in diesen Jahren. Höch und ihre Dada-Puppen wurden in Heft 5 des Kabaretts „Schall und Rauch“ abgebildet.
In der ersten und einzigen Nummer der Zeitschrift „NG“ der Novembergruppe im Mai 1921, deren Einband von Höch stammt, erschien ihrer Schilderung „Reise nach Italien“. Über die Novembergruppe hielt die Künstlerin regen Kontakt zu Adolf Behne (1885–1948), Otto Freundlich, Rudolf Belling, Hugo Häring und anderen. Gemeinsam mit Hausmann, Kurt und Helma Schwitters reiste sie nach Prag, um dort Dada-Abende zu veranstalten. Es begann eine tiefe, dauerhafte und konstruktive Freundschaft mit dem Künstler und Grafiker Kurt Schwitters (1887–1948). Erste Kontakte zu De Stijl. Der Freund, Publizist und Architekt Adolf Behne reiste bereits 1920 nach Holland, vermittelte zwischen den holländischen Künstlern und Architekten Theo van Doesburg (1883–1931) und J.J.P. Oud (1890–1963) und dem Bauhaus. Beide hielten in den folgenden Jahren Vorträge sowohl in Berlin als auch in Weimar.
Obwohl Hannah Höch 1922 eine Einladung für den „Konstruktivisten- und Dadaisten-Kongress Weimar“ hatte, nahm sie nicht teil. Im „Merz-Bau“ von Schwitters in Hannover gestaltete Höch ihre erste Grotte „Bordell“ – gefolgt von einer zweiten Grotte 1925 – und auf der „Großen Berliner Kunstausstellung“ zeigte sie „Frau und Saturn“ und „Er und sein Milieu“. Über die Jour Fixes bei Segal schloss Hannah Höch Kontakte zu Viking Eggeling, Wassily Kandinsky, Hans Richter, Walter Ruttmann, El Lissitzky, Ernst Simmel und anderen.
Im Januar 1923 unternahm Höch mit ihren Freund:innen den „Dada-Feldzug“ in Holland mit den Stationen Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Delft, Leiden7 unter Beteiligung von Theo van Doesburg, Nelly van Doesburg und Vilmos Huszár. Letzterer war später Logiergast von Höch in Berlin. Die Künstlerin schloss Kontakte zu László Moholy-Nagy, Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp. Gemeinsam mit den Ehepaaren Schwitters und Arp verbrachte Hannah Höch den Sommer 1923 auf Rügen. Das Merz-Heft 1 zum Thema „Holland Dada“, herausgegeben von Kurt Schwitters, erschien 1923 in Hannover, darin eine Zeichnung von Höch.
Auf Einladung des Ehepaars van Doesburg reiste Hannah Höch 1924 nach Paris, wo sie Tristan Tzara, Piet Mondrian, Robert Delaunay und Sonia Delaunay-Terk, Lou Albert-Lasard, Amédée Ozenfant, Man Ray, Iwan Puni, Fernand Léger und andere kennenlernte. Höchs Wohnung in Berlin entwickelte sich zur Anlauf- und Poststelle und zu einem Depot für die Künstlerfreunde, die Ausstellungs-, Publikations- und Kontaktmöglichkeiten suchten. „Erste Allgemeine Deutsche Kunstausstellung in Sowjet-Russland“ (18.10.–November 1924) im Staatlichen Historischen Museum Moskau, mit weiteren Stationen in Saratow (Dezember 1924–März 1925) und Leningrad (Mai–Juli 1925). Höch nahm mit „Die Mücke ist tot“ und „Er und sein Milieu“ teil.8
Am 5. November 1924 fand eine Privatveranstaltung in Berlin mit der Aufführung von Viking Eggelings Film „Diagonale Symphonie“ statt, anwesend waren unter anderem Adolf Behne, Arthur Segal, László Moholy-Nagy und Werner Graeff.9
Schwitters und Höch begannen 1925 mit den Planungen der „Anti-Revue“ „Schlechter und Besser“, die allerdings nie umgesetzt wurde. Auf der Ausstellung der Novembergruppe in den Räumen der Berliner Secession wurden erstmals Höchs „Die Journalisten“ und „Roma“ ausgestellt (der Städtischen Ankaufskommission von Mies van der Rohe empfohlen, aber abgelehnt10), auf der Juryfreien Kunstschau „Vita immortalis“ sowie zwei Aquarelle. Höch besuchte London, die Isle of Wight, mit den van Doesburgs die bretonische Insel Belle-île und Paris, wo sie die „Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes“ sah. Traf Otto Freundlich, Tristan Tzara, Piet Mondrian, die van Doesburgs, Robert Delaunay, Friedrich Kiesler, Francis Picabia. Hans Arp und El Lisstzky bildeten in ihrer Publikation „Die Kunstismen“ das Ölgemälde „Die Etiketten wollen sich hervortun“ ab. Moholy-Nagy veröffentlichte in seiner Bauhaus-Publikation „Malerei, Photographie, Film“ Höchs Collage „Hochfinanz“ unter dem Titel „Der Milliardär“.
Höch in den Niederlanden (1926–1929)
Auf Einladung von Kurt Schwitters reiste Hannah Höch 1926nach Holland-Reise. Dort lernte sie die Übersetzerin und Autorin Til Brugman (1888–1958) kennen. Brugman schrieb Gedichte, Grotesken und Prosa. Hannah Höch ging eine Beziehung mit Brugman ein, die bis 1935 dauerte. Hannah Höch übersiedelte deshalb nach Den Haag. Das Paar unternahm gemeinsame Reisen nach Belgien, Schweiz und Norditalien, nach Paris 1927, Norwegen 1928.
Im Jahr 1928 wurde Hannah Höch Mitglied der „Filmliga Rotterdam“. Am 28. Januar kam es zur Aufführung von Man Rays Film „Emak Bakia. Un Cinépoème“, am 3. März von Eggelings „Symphonie Diagonale“ sowie von Filmen Hans Richters und J.C. Mols („Uit het rijk der kristallen“). Höch nahm an diversen Ausstellungen des holländischen Pendants zur Novembergruppe, „De Onafhankelijken“, teil: 1928 etwa mit „Imaginäre Brücke“ (später: „Zwei Köpfe“), „Die Treppe“, „Schwarz-Weiß“; 1929 mit „Er und sein Milieu“ sowie „Das Brautpaar“.
Hannah Höch hatte in den Niederlanden 1929 ihre ersten Einzelausstellungen: in der Galerie De Bron in Den Haag – ihre Gemälde, Aquarelle und Collage wurden eher zurückhaltend bis ablehnend kritisiert –, im Rotterdamsche Kring (Anfang September), im Kunstzaal van Lier in Amsterdam. Die Wanderausstellung „Film und Foto“ des Deutschen Werkbundes zeigte in Stuttgart 18 Fotomontagen der Künstlerin (weitere Etappen: Zürich, Berlin, Danzig, Wien, Zagreb, Tokio, Osaka). Hannah Höchs Fotomontagen erschienen in „Foto-Auge: 76 Fotos der Zeit“ von Franz Roh und Jan Tschichold. Am 1. November 1929 zogen Til Brugman und Höch zurück nach Berlin. Auch danach blieben ihr die holländischen Galerien verbunden: 1934 und 1935 organisierte die Galerie D’Audretsch in Den Haag eine Einzelausstellungen Höchs.
Berlin
Eine für Mai bis Juni 1932 geplante Einzelausstellung im Bauhaus Dessau mit Fotomontagen und Aquarellen wurde abgesagt. Es entstanden zum Broterwerb Buchumschläge für den Verlag von Anthon Bakels in Berlin. Künstlerisch wichtige Stationen waren in den Jahren 1932 und 1933 Höchs Teilnahme am ersten „Philadelphia International Salon of Photography“ und an der ersten „Exposition internationale de la photographie et du cinéma“ in Brüssel.
Nach einer Basedow-Operation 1934 machte Hannah Höch eine Kurs in Johannisbad im Riesengebirge und in den Dolomiten – eine große finanzielle Belastung. Til Brugman bemühte sich bei Galeristen, Sammlern und Freunden um Unterstützung durch Verkäufe. Eine von František Kalivoda organisierte Einzelausstellung Höchs mit 42 Fotomontagen fand in Brünn statt; Hannah Höch schrieb einen Text zur Fotomontage im Katalog.
Während eines neuerlichen Kuraufenthalts in den Dolomiten 1935 lernte Hannah Höch den Pianisten und Volkswirtschaftler Kurt Matthies (1910–?) kennen, den sie nach der Trennung von Brugman 1938 heiratete.
Höch in der NS-Diktatur
Noch 1936 konnte Hannah Höch an der Ausstellung „Deutsche Frauenkunst der Gegenwart“ im Mannheimer Kunstverein teilnehmen. Im Katalog der Ausstellung „Fantastic Art, Dada, Surrealism“, kuratiert von Alfred Barr im Museum of Modern Art in New York, wurde das „Klebebild XI“ (1921) aus der Sammlung Tristan Tzara abgebildet. Doch ihre Aufnahme als „Kulturbolschewistin“ in Wolfgang Willrichs „Säuberung des Kunsttempels“ (1937) mit dem Gemälde „Journalisten“ zeigte die Änderung der Kunst- und Kulturpolitik an. Hannah Höch erhielt „Ausstellungsverbot“. Die Künstlerin besuchte in mehreren Städten die Ausstellung „Entartete Kunst“. An der Seite von Kurt Matthies, der für die jüdische Firma und Eisengießerei Schönthal tätig war, konnte Höch noch zahlreiche Reisen über die Sächsische Schweiz und den Thüringer Wald nach Süd- und Südwestdeutschland. Diese verband sie stets mit Museumsbesuchen (u.a. in Darmstadt, Mannheim, Otterlo, Amsterdam, Rotterdam). Höch schuf Gemälde, Aquarelle, Skizzen und gab Kurse in der ehemaligen Reimann-Schule.
Hannah Höch heiratete 1938 Kurt Matthies. Es folgten insgesamt unstete Jahre, eine problematische Beziehung (1942 die Trennung und 1944 die Scheidung). Die politische Situation wie auch die persönlichen Umstände lasteten schwer auf Höchs Gesundheit. Sie berichtete in ihren Tagebüchern von Angstzuständen und Herzbeschwerden. Daneben kommentierte sie kurz und knapp die politischen Ereignisse. Die Kriegserklärung 1939 erlebte Höch in Gotha während eines Zwischenaufenthaltes bei ihrer Mutter. Auf ihren Reisen traf Höch (noch) Freunde, unter anderem Prof. Dr. Hildebrandt, Willi Baumeister und Oskar Schlemmer in Stuttgart, dort besichtigte sie auch die Weissenhofsiedlung.
Dank einer kleinen Summe aus der elterlichen Erbschaft erwarb Hannah Höch ein ehemaliges Flugwärterhäuschen in Berlin-Heiligensee. Dorthin brachte sie Dokumente und Werke ihrer Freunde aus ehemaligen Dada-Zeiten. Nach ihrer Scheidung 1944 lebte Höch zurückgezogen in Heiligensee, wo sie zunehmend vereinsamte. Ihr Garten gewann an Bedeutung, als Ausgleich und zur Ernährung. Wenige Kontakte blieben erhalten, wie zu Thomas Ring, den sie bereits seit der Studienzeit bei Orlik kannte, oder Adolf Behne. Mit beiden pflegte sie in all diesen Jahren einen unregelmäßigen Briefwechsel.
Nachkriegszeit
Hannah Höch berichtete 1945 vom Einmarsch der Russen. Sie engagierte sich sofort im kulturellen Wiederaufbau. Im September nahm sie auf Einladung an der Gründungsversammlung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschland teil. Sie lernte Heinz Trökes kennen, den Mitbegründer der Galerie Gerd Rosen, und hielt ihren ersten Vortrag: „Die Symbolik der Kunst“.
Im Jahr 1946 als „wichtige Kulturschaffende“ anerkannt, erhielt Hannah Höch Anrecht auf eine Lebensmittelkarte I. Wie Höchs Tagebücher verraten, waren Arbeitsmaterialien ebenso wie Lebensmittel knapp. Adolf Behne war in einem selbstständigen Ressort für Volksbildung und Kunst sehr engagiert und lud Höch zu mehreren Ausstellungen im Rahmen der Notstandsprogramme ein. Sie war regelmäßig auf den Ausstellungen des Volksbildungsamtes in Reinickendorf vertreten, hielt unverdrossen Vorträge über die Anliegen der modernen Kunst, unter anderem in der Volkshochschule Reinickendorf, insbesondere gerichtet an die jüngeren Generationen.
Im Februar 1946 organisierte die Galerie Gerd Rosen die Ausstellung „Fantasten“ (gemeinsam mit Hans Uhlmann, Mac Zimmermann, Hans Thiemann, Stephen Alexander und Heinz Trökes). Höch verfasste die Einführung zum Katalog, in der sie sich zu einer Sur-Realität bekannte. Mitarbeit am „Ulenspiegel“, der Zeitschrift für Literatur, Kunst und Satire, wo Fotomontagen und Aquarelle Höchs abgedruckt wurden. Ihr letzter Beitrag 1949 ist das Aquarell „Der Mensch schreit“. Im Dezember 1946 beteiligte sich Hannah Höch an der Ausstellung „Fotomontage von Dada bis heute“ in der Galerie Gerd Rosen, daneben waren Arbeiten von Raoul Hausmann, Johannes Baader, Juro Kubicek und anderen zu sehen. Ihr Text zur Fotomontage, bereits verfasst für die Ausstellung in Brünn 1934, erschien im Katalog.
Im Herbst 1948 war Hannah Höch mit drei Fotomontagen in der Ausstellung „Collage“ im Museum of Modern Art in New York vertreten. Sie stellte auch Werke von Baader und Hausmann als Leihgaben zur Verfügung. Über Jahre kämpfte die Künstlerin dennoch ums nackte Überleben. Höch beantragte Sozialhilfe, erhielt ein Darlehen aus dem Künstler-Hilfs- und Altersfonds, das sie 1949 zurückzahlen musste. Daher gab sie 1948/49 Kurse an der Volkshochschule Reinickendorf, wobei sie sich ausführlich auf Wilhelm Worringers „Abstraktion und Einfühlung“ bezog.11
Im Jahr 1949 trat Hannah Höch aus dem Schutzverband bildender Künstler aus, weil sie sich den Beitrag nicht leisten konnte. Einzelausstellung in der Galerie Franz mit Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Fotomontagen, ergänzt durch Arbeiten von Hausmann, Schwitters, Arp und Freundlich. Höch nahm nun an diversen Gruppenausstellungen teil, zum Beispiel an „Reinickendorfer Künstler stellen aus. Malerei, Graphik, Plastik“ im Volksbildungsamt Reinickendorf 1945 und 1949 im Archivarion an der Milly-Steger-Gedächtnis-Ausstellung sowie an der Grafikausstellung des Bezirksamtes Charlottenburg.
Als 1950 der unabhängige Berufsverband Bildende Künstler in Berlin gegründet wurde, war mit dabei Hannah Höch. Zahlreiche Bitten der Künstlerin auf Erlass der Mitgliedsbeiträge und Sonderzuschüsse für den Erwerb von Malmaterial sind überliefert. Die Künstlerin war regelmäßig auf den Ausstellungen vertreten, ebenso bei den Veranstaltungen anderer Verbände, wie „Der Ring“ oder der Verein Berliner Künstler.
Die Wiederaufnahme von Kontakten zu Hausmann, Hans Richter, Richard Huelsenbeck erfolgte 1951. Hannah Höch verletzte sich das rechte Auge im Garten. Im Dezember besuchte sie eine Ausstellung von Max Ernst im Haus am Waldsee, den sie als ihren „nächsten ‚Verwandten‘“ bezeichnete. Höch beteiligte sich aktiv am Berliner Kulturleben, besuchte Ausstellungen, Vorträge, Film- und Theatervorführungen. Freundschaft mit dem Schriftsteller Karl Friedrich Borée. Besuch von Hannah Kosnick-Kloss-Freundlich, die Nachrichten aus Paris überbrachte.
Hannah Höch nahm 1953 an der Ausstellung „Landschaft und Stillleben, Porträt und Plastik“ im Rathaus Neukölln sowie an der „Juryfreien Kunstausstellung“ und Reinickendorfer Ausstellungen teil. Sie erhielt finanzielle Hilfe durch die Deputation für Volksbildung und Kunst des Bezirkamts Reinickendorfs, allerdings erkrankte sie an Hepatitis. In der Ausstellung „Dada 1916–1923“ bei Sidney Janis in New York waren fünf Werke von Höch dabei. Im November hörte sie ein Interview mit Max Ernst im Radio, das sie tief bewegte. Mehrere Briefentwürfe an Ernst schickte sie allerdings nicht ab.
Anlässlich ihres 65. Geburtstages 1954 und bis zu ihrem Tod erhielt Höch auf Empfehlung von Hans Arp ein „Ehrenruhegeld“ der Stadt Berlin. Höch sah die Ausstellung von Max Ernst in der Galerie Springer. Im Folgejahr reiste sie ins Rheinland, traf Georg Muche, Max Burchartz, Werner Graeff. Die Galerie des 20. Jahrhunderts, Vorgängerinstitution der Nationalgalerie, erwarb das Ölbild „Die Mücke ist tot“.
Im Jahr 1957 organisierte die Galerie Gerd Rosen, Berlin, eine Einzelausstellung Höchs mit 26 Collagen. Parallel dazu wurde afrikanische Stammeskunst gezeigt. Außerdem nahm sie an der „Großen Berliner Kunstausstellung“ teil. Höch besaß ein ausgeprägtes Interesse an technischen Entwicklungen. Sie verfolgte mit höchster Aufmerksamkeit die Eroberung des Weltalls, sammelte dazu Artikel und Fotomaterial zu den Bewegungen der ersten russischen Erdsatelliten Sputnik 1 und 2 in der Umlaufbahn. Der Blick von oben – oder außen – auf die Dinge, die Relativierung der Verhältnisse, die innovativen Perspektiven waren der Künstlerin stets von Bedeutung. Ihr sich nun erweiternder Bekanntenkreis setzte sich aus Physikern, Kunsthistorikern, Musikern, Künstlern, Sammlern, Kritikern, Schriftstellern zusammen.
Auf der Ausstellung „Dada – Dokumente einer Bewegung“ (1958) in Düsseldorf wurde Höch mit 21 Arbeiten gezeigt. Auf der Eröffnung am 5. September traf sie Man Ray, Hans Richter, Paul Citroen und Hans Bolliger. Höch galt als zentrale Zeitzeugin. Sie beteiligte sich außerdem an der Ausstellung „Berliner Künstler: Malerei, Plastik“, Bezirksamt Spandau.
Zu Ehren ihres 70. Geburtstages widmet der „Ring bildender Künstler“ Hannah Höch im Rahmen seiner Ausstellung im Haus am Waldsee eine eigene Sektion (1960). Sie schenkte Arp die Arbeiten „Huldigung an Arp“ und „Schnurbild“. Ab März erhielt sie bis an ihr Lebensende finanzielle Unterstützung durch die Deutsche Künstlerhilfe, einem Fonds aus Fördermitteln der Bundesministerien und Spenden.
Von Januar bis April 1961 war Hannah Höch Ehrengast der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Kontakt zu Palma Bucarelli, Direktorin der Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Rom, sowie zu Arturo Schwarz, Mailand. Höch-Retrospektive in der Galerie Nierendorf, Berlin (April–Juni). Die Galerie vertrat nun die Künstlerin. Die Nationalgalerie erwarb „Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands“. Im Sommer entstand der Dokumentarfilm „Hannah Höch – jung geblieben“ von Hans Cürlis. Im Oktober war Höch auf der Ausstellung „The Art of Assemblage“ im Museum of Modern Art vertreten. Die Künstlerin verfolgte weiterhin Neuerungen auf dem Gebiet der Kunst, der Architektur, Film und Fotografie, in Technologie und Atomenergie.
Höch besuchte die „Documenta III“ (1964) in Kassel. Zum 75. Geburtstag organisierte die Galerie Nierendorf eine Retrospektive der Künstlerin. Die Verkäufe dienten dazu, eine Zwangsvollstreckung des Häuschens zu verhindern. Höch musste sich beständig „über Wasser halten“, zum Beispiel durch Privatunterricht im Zeichnen. Beteiligung an der Ausstellung „Behauptung der Kunst“ des Deutschen Künstlerbundes, Haus am Waldsee, Berlin, sowie an der Ausstellung „Cinquante ans de collages: Papiers collés, assemblages, collages, du Cubisme à nos jours“, Musée d’Art et d’Industrie, Saint- Étienne, Musée des Arts Décoratifs, Paris.
Höch pflegte 1965 den Kontakt zum italienischen Bildhauer und Berlin-Stipendiaten Emilio Vedova, den sie mehrmals in seinem Berliner Atelier besuchte. Die Abteilung Bildende Kunst der Akademie der Künste, Berlin, wählte Höch zum ordentlichen Mitglied. Beteiligt an den Ausstellungen „Signale, Manifeste, Proteste im 20. Jahrhundert“ im Rahmen der Ruhrfestspiele in der Städtischen Kunsthalle Recklinghausen sowie „Dada bis heute“, Neue Galerie der Stadt Linz, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz. Leihgaben aus dem Besitz von Höch auf der großen Schwitters-Retrospektive in Los Angeles, Kansas City, Toronto, Dallas, St. Louis. Beschäftigung mit den Gemini-Raumflügen.
Im Jahr 1966 wurde Hannah Höch eingeladen zu einem Vortrag zur Berliner Dada-Zeit im Kunstverein Düsseldorf. Vermehrt suchten Fluxus-Künstler:innen den Kontakt zu Höch. Unter anderem wurde sie von Nam June Paik und Charlotte Moorman, von Wolf Vostell, Dick und Alison Higgins, von Juan Hidalgo besucht.
Eberhard Roters, späterer Gründungsdirektor der Berlinischen Galerie, beauftragte Heinz Ohff mit der Erstellung einer ersten Biografie zu Höch. Es erschien 1968 die erste Monografie zu Höch von Heinz Ohff, erster Band der Reihe „Bildende Kunst in Berlin“, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Bildende Kunst (Kunstverein Berlin) und von der Stiftung Buchkunst unter die schönsten Bücher des Jahres gereiht. 1967, 1968 und 1978 erhielt Höch eine Spende der Theodor-Heuss-Stiftung.
Im Jahr 1969 zeigte Hannah Höch reges Interesse an den Apollo-Landungen auf dem Mond. Helga Kliemann veröffentlichte Werke von Höch in ihrer monografischen Untersuchung zur Novembergruppe, und Wieland Schmied nahm sie in seinem Buch „Neue Sachlichkeit und Magischer Realismus in Deutschland 1918–1933“ auf.
Die Deutsche Welle sendete am 2. Juli 1970 „Das Porträt: Hannah Höch“. Es stellten sich Probleme mit der Sehkraft ein. Die Künstlerin sammelte Material zu diversen Themen, die sie in Rubriken unterteilte, wie Astronautik, Mikrokosmos, Pflanzen, Blumen, aber auch Religion und Sex, für eine große Collage.
Der Sender Freies Berlin brachte 1971 das Interview „Alt werden, jung bleiben“. Höch sammelte weiterhin Artikel und Material zu zahlreichen Themen, unter anderem zu Gesteinsproben auf dem Mond, zu Parapsychologie und zeitgenössischer Musik und Tanz.
Höch begann 1972 mit der Großcollage „Lebensbild“ und stellte Leihgaben für die Ausstellung „Salomo Friedlaender / Mynona“, Akademie der Künste, Berlin, zur Verfügung.
Hannah Höch führte ein Gespräch mit Wolfgang Pehnt in der Reihe „Jene zwanziger Jahre“ im Deutschlandfunk (4.3.1973). Ein Filmporträt von Sigurd Kuschnerus wurde im Sender Freies Berlin am 23. November ausgestrahlt.
Im Jahr 1974 wurde Hannah Höch am grauen Star operiert. Sie arbeitete nun mit einem Vergrößerungsglas. In diesem Jahr erwarb der Senat für Wissenschaft und Kunst die Gemälde „Roma“ und „Journalisten“.
Tod
Hannah Höch starb am 31. Mai im Alter von 88 Jahren.
Beiträge zu Hannah Höch
Biografie von Hannah Höch (1.11.1889–31.5.1978)
1.11.1889
Hannah Höch wurde als Anna Therese Johanne Höch am 1. November 1889 in Gotha (Thüringen) geboren. Ihr Vater war Inspektor der Stuttgarter Versicherungen, die Mutter dem „Schöngeistigen“ zugewandt. Höch wuchs in einem gutbürgerlichen Ambiente auf. Der Vater war Mitglied der Gothaer Freimaurerloge „Ernst zum Compass“ (der Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“, Berlin), ihre Erziehung geprägt von den reformerischen Leitsätzen Friedrich Wilhelm August Fröbels (1782–1852), der zur Förderung der kreativen Anlagen des Kindes Klebebilder oder Baukastenspiele empfahl.1912
Höch begab sich zur Ausbildung an die Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Charlottenburg, frequentiert die Klasse 6 für Glasgestaltung unter Leitung von Harold Bengen. Zu den Unterrichtsschwerpunkten zählten „Flächenkunst, Glasmalerei, Musterzeichnen, Modezeichnen und Stickereientwürfe“, das Naturstudium. Besuchte Kurse des Schriftkünstlers Ludwig Sütterlin (1865–1917). Herwarth Walden (1878–1941) gründete die „Sturm“-Galerie (bestand bis 1932), ein Zentrum der Avantgarde-Ausstellungen und des Expressionismus.1914
Hannah Höch reiste mit einem Stipendium zur Werkbund-Ausstellung nach Köln. Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die Kunstschulen wurden vorübergehend geschlossen. Höch kehrte nach Gotha zurück und arbeitete als Hilfskraft beim Roten Kreuz.1915
öch zog wieder nach Berlin und wechselte in die Klasse Emil Orliks für Grafik und Buchkunst an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums, wo sie vom Sommerquartal 1915 bis zum Winterquartal 1919/20 studierte. Daneben besuchte sie Abendkurse in Kalligrafie und Modellzeichnen sowie die Holzschnittklasse von Oskar Bangemann (1882–nach 1942). Höch war 1916 und 1917 als Freischülerin, ab 1918 als Stipendiatin verzeichnet. Natur- und Aktstudien standen im Vordergrund. Auch George Grosz besuchte mit Höch seit 1913 die Orlik-Klasse. Erste Kontakte zum „Sturm“-Kreis. Höch lernte Raoul Hausmann (1886–1971) und Johannes Baader (1875–1955) sowie Salomo Friedlaender / Mynona (1871–1946) kennen. Eine konfliktreiche Beziehung zu Hausmann begann, die bis 1922 dauerte. Höch beschäftigte sich mit Schriften von Wassily Kandinsky, mit Nietzsche, den Theorien von Salomo Friedlaender. Höch war darüber hinaus seit ihrer Jugend an Philosophie interessiert.1916: Ullstein Verlag
Seit 1. Januar arbeitete Höch zum Broterwerb drei Tage die Woche in der Handarbeitsredaktion des Ullstein Verlages (bis 1926). Sie fertigte Schriftvorlagen, Vignetten, Illustrationen, Entwürfe, Filetmuster und Handarbeitsvorlagen für die Zeitschriften „Die Dame“ und „Die praktische Berlinerin“. Es entstanden Linolschnitte, die später in die Mappe „Miniaturen“ (1964) einflossen, sowie Stoff- und Tapetenmusterrapporte. Höchs Stickmuster erschienen in der „Stickerei- und Spitzen-Rundschau“.1918
Richard Huelsenbeck (1892–1974), Arzt und Autor, brachte Dada 1917 nach Berlin. Am 22. Februar 1918 hielt er im Saal der Berliner Secession die „Erste Dada-Rede in Deutschland“. Gründung des Club Dada, ein erster dadaistischer Vortragsabend fand am 12. April statt. Raoul Hausmann trug sein Manifest „Das neue Material in der Malerei“ vor, jedenfalls teilweise, denn Tumult brach aus. Hausmann und Höch entdeckten die schöpferischen Potenziale der Fotomontage. Höch publizierte mehrere Artikel in der „Stickerei- und Spitzen-Rundschau“, in denen sie einen engen Zusammenhang der Stickerei mit der Malerei postulierte.1919
Arbeiter- und Soldatenräte wurden durch die Nationalversammlung ersetzt. Künstler:innen organisierten sich politisch im „Rat geistiger Arbeiter“ und im „Arbeitsrat für Kunst“. Hausmann setzte sich in philosophisch-politischen Essays in den Zeitschriften „Der Einzige“ und „Die Erde“ mit den Geschehnissen auseinander. Erste Berliner Dada-Ausstellung im Graphischen Kabinett J. B. Neumann. Höch zeigte abstrakte Aquarelle und Zeichnungen. Entstehung von „Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands“. Spätestens seit 1919 Bekanntschaft mit Kurt Schwitters und Kenntnis von Hans Arps Poesien. Höch verfolgte und sammelte eine Fülle von avantgardistischen Zeitschriften. Zwischen Höch und Hausmann periodische Zerwürfnisse. Hausmann belehrte Höch in umfangreichen Notizheften zur Befreiung des Selbst, insbesondere zur weiblichen Befangenheit in patriarchalischen Strukturen. Höch wurde Mitglied der Novembergruppe.1919–1926
Hannah Höch nahm regelmäßig an der „Großen Berliner Kunstausstellung“ teil.1920
„Erste Internationale Dada-Messe“ in der Kunsthandlung Dr. Otto Burchard. Höch zeigte mehrere Collagen, unter anderem „Collage mit Pfeil“, zwei Dada-Puppen und eine verschollene Dada-Plastik. Infolge diverser Auseinandersetzungen mit Hausmann reiste Höch nach Italien. Kontakt zu den Futuristen, insbesondere zu Enrico Prampolini, über den sie die Zeitschriften „Atys“ und „noi“ kennenlernte, und Filippo Tommaso Marinetti. Das Visum erhielt sie durch die Vermittlung von Mies van der Rohe. Besuchte in München die „Expressionistischen Werkstätten“. Über Kontakte von Hans Hofmann wurden zwei ihrer Dada-Puppen und nach den Entwürfen von Raoul Hausmann gestickte Kissen auf der Ausstellung „Junge Kunst Deutschlands“ in Chicago gezeigt. Kontakt zur Verlagsanstalt Alexander Koch, Darmstadt, der die Kunstzeitschriften „Deutsche Kunst und Dekoration“, „Stickerei- und Spitzen-Rundschau“, „Innendekoration“ und die „Tapeten-Zeitung“ herausgab. Höch besuchte Soireen bei dem rumänisch-stämmigen Maler Arthur Segal (1875–1944) und später auch bei dem Neurologen und Psychoanalytiker Ernst Simmel (1882–1947). Sie beschäftigte sich ausgiebig mit Psychologie und Psychoanalyse. Eine Reihe von abstrakt-konstruktiven Werken entstanden in diesen Jahren. Höch und ihre Dada-Puppen wurden in Heft 5 des Kabaretts „Schall und Rauch“ abgebildet.1921
In der ersten und einzigen Nummer der Zeitschrift „NG“ der Novembergruppe im Mai 1921, deren Einband von Höch stammt, erschienen neben ihrer Schilderung „Reise nach Italien“ Texte von Raoul Hausmann („Die Kunst und die Zeit“), des Philosophen und Groteskenverfassers Salomo Friedlaender / Mynona („Das kosmische Gehirn“, eine Besprechung der Erkenntnisse von Ernst Marcus, Philosoph, 1856–1928) sowie des Künstlers, Grafikers und Bildhauers Oswald Herzog (1881–1941, „Vom Ausdruck der Form“). Über die Novembergruppe reger Kontakt Höchs zu Adolf Behne, Otto Freundlich, Rudolf Belling, Hugo Häring und anderen. Prag-Reise mit Hausmann, Kurt und Helma Schwitters. Dada-Abende in Prag. Es begann eine tiefe, dauerhafte und konstruktive Freundschaft mit dem Künstler und Grafiker Kurt Schwitters (1887–1948). Erste Kontakte zu De Stijl. Der Freund, Publizist und Architekt Adolf Behne (1885–1948) reiste bereits 1920 nach Holland, vermittelte zwischen den holländischen Künstlern und Architekten Theo van Doesburg (1883–1931) und J.J.P. Oud (1890–1963) und dem Bauhaus. Beide hielten in den folgenden Jahren Vorträge sowohl in Berlin als auch in Weimar.1922
Trennung von Hausmann. Konstruktivisten- und Dadaisten-Kongress Weimar: Höch war eingeladen, nahm aber nicht teil. Gestaltete ihre erste Grotte „Bordell“ im „Merz-Bau“ von Schwitters in Hannover. Auf der „Großen Berliner Kunstausstellung“ zeigte Höch „Frau und Saturn“ und „Er und sein Milieu“. Über die Jour Fixes bei Segal Kontakte zu Viking Eggeling, Wassily Kandinsky, Hans Richter, Walter Ruttmann, El Lissitzky, Ernst Simmel und anderen.1923
Im Januar „Dada-Feldzug“ in Holland mit den Stationen Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Delft, Leiden unter Beteiligung von Theo van Doesburg, Nelly van Doesburg und Vilmos Huszár. Letzterer war später Logiergast von Höch in Berlin. Kontakte zu László Moholy-Nagy, Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp. Gemeinsamer Sommeraufenthalt mit den Schwitters’ und den Arps auf Rügen. Das Merz-Heft 1 zum Thema „Holland Dada“, herausgegeben von Kurt Schwitters, erschien 1923 in Hannover, darin eine Zeichnung von Höch.1924
Paris-Reise auf Einladung des Ehepaars van Doesburg; Hannah Höch lernte Tristan Tzara, Piet Mondrian, Robert Delaunay und Sonia Delaunay-Terk, Lou Albert-Lasard, Amédée Ozenfant, Man Ray, Iwan Puni, Fernand Léger und andere kennen. Höchs Wohnung in Berlin entwickelte sich zur Anlauf- und Poststelle und zu einem Depot für die Künstlerfreunde, die Ausstellungs-, Publikations- und Kontaktmöglichkeiten suchten. „Erste Allgemeine Deutsche Kunstausstellung in Sowjet-Russland“ in Moskau. Höch nahm mit „Die Mücke ist tot“ und „Er und sein Milieu“ teil. Privatveranstaltung in Berlin am 5. November mit der Aufführung von Viking Eggelings Film „Diagonale Symphonie“, anwesend unter anderem Adolf Behne, Arthur Segal, László Moholy-Nagy und Werner Graeff.1925
Gestaltung einer zweiten Grotte in Schwitters’ „Merz-Bau“. Schwitters und Höch begannen mit den Planungen der „Anti-Revue“ „Schlechter und Besser“. Die Revue wurde nie umgesetzt. Auf der Ausstellung der Novembergruppe in den Räumen der Berliner Secession wurden erstmals Höchs „Die Journalisten“ und „Roma“ ausgestellt (der Städtischen Ankaufskommission von Mies van der Rohe empfohlen, aber abgelehnt), auf der Juryfreien Kunstschau „Vita immortalis“ sowie zwei Aquarelle. Höch besuchte London, die Isle of Wight, mit den van Doesburgs die bretonische Insel Belle-île und Paris, wo sie die „Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes“ sah. Traf Otto Freundlich, Tristan Tzara, Piet Mondrian, die van Doesburgs, Robert Delaunay, Friedrich Kiesler, Francis Picabia. In „Die Kunstismen“ von Hans Arp und El Lisstzky wurde das Ölgemälde „Die Etiketten wollen sich hervortun“ publiziert, darüber hinaus die Collage „Hochfinanz“ unter dem Titel „Der Milliardär“ in Moholy-Nagys Bauhaus-Publikation „Malerei, Photographie, Film“.1926
Holland-Reise auf Einladung von Kurt Schwitters. Lernte die Übersetzerin und Autorin Til Brugman (1888– 1958) kennen. Brugman schrieb Gedichte, Grotesken und Prosa. Die Beziehung mit Brugman währte bis 1935. Höch übersiedelte nach Den Haag (bis 1929). Gemeinsame Reisen nach Belgien, Schweiz und Norditalien.1927
Parisreise mit Til Brugman.1928
Höch wurde Mitglied der Filmliga Rotterdam. Am 28. Januar Aufführung von Man Rays Film „Emak Bakia. Un Cinépoème“, am 3. März von Eggelings „Symphonie Diagonale“ sowie von Filmen Hans Richters und J.C. Mols („Uit het rijk der kristallen“). Höch nahm an diversen Ausstellungen des holländischen Pendants zur Novembergruppe, „De Onafhankelijken“, teil, 1928 etwa mit „Imaginäre Brücke“ (später: „Zwei Köpfe“), „Die Treppe“, „Schwarz-Weiß“. Große Norwegenreise mit Til Brugman.1929
Teilnahme an der Jahresausstellung der Onafhankelijken im Stedelijk Museum Amsterdam mit „Er und sein Milieu“ sowie „Das Brautpaar“. Erste Einzelausstellung in der Galerie De Bron in Den Haag über Vermittlung von Jan Buijs (Architekt und Kristallsammler, 1889–1961) mit Gemälden, Aquarellen und Collagen. Die Kritiken sind dazu eher zurückhaltend bis ablehnend. Anfang September Einzelausstellung im Rotterdamsche Kring. Weitere Einzelausstellung im Kunstzaal van Lier, Amsterdam. Die Wanderausstellung „Film und Foto“ des Deutschen Werkbundes zeigte in Stuttgart 18 Fotomontagen (weitere Etappen: Zürich, Berlin, Danzig, Wien, Zagreb, Tokio, Osaka). Hannah Höchs Fotomontagen erschienen in „Foto-Auge: 76 Fotos der Zeit“ von Franz Roh und Jan Tschichold. Am 1. November zogen Til Brugman und Höch zurück nach Berlin.1931
Teilnahme an der „Großen Berliner Kunstausstellung“, wie im Vorjahr 1930. Höch beteiligte sich auch an der Ausstellung „Frauen in Not“ gegen den Paragrafen 218 im Haus der Juryfreien in Berlin, ebenso wie an der von César Domela organisierten Ausstellung „Fotomontage“ im Lichthof des ehemaligen Berliner Kunstgewerbemuseums, dabei auch Arbeiten von László Moholy-Nagy, Paul Schuitema, Kurt Schwitters, Jan Tschichold, Friedrich Vordemberge-Gildewart und anderen. Teilnahme an der Ausstellung „Das Lichtbild“ in Essen. Höch wurde Mitglied der Deutschen Liga für unabhängigen Film und im Reichsverband bildender Künstler. Frequentierte die Jour Fixes bei Ernst Simmel.1932
Wandertour von Berchtesgaden und die Tauern über den Großglockner bis Lienz. Eine für Mai bis Juni geplante Einzelausstellung im Bauhaus Dessau mit Fotomontagen und Aquarellen wurde abgesagt. Höch beteiligte sich am ersten „Philadelphia International Salon of Photography“ (ebenso 1933). Es entstanden zum Broterwerb Buchumschläge für den Verlag von Anthon Bakels in Berlin. Teilnahme an der ersten „Exposition internationale de la photographie et du cinéma“ in Brüssel (ebenso 1933) mit sieben Collagen.1934
Einzelausstellung in der Galerie D’Audretsch in Den Haag. Basedow-Operation und Kuraufenthalt in Johannisbad im Riesengebirge und in den Dolomiten – eine große finanzielle Belastung. Til Brugman bemühte sich bei Galeristen, Sammlern und Freunden um Unterstützung durch Verkäufe. Eine von František Kalivoda organisierte Einzelausstellung Höchs mit 42 Fotomontagen fand in Brünn statt. Text von Höch zur Fotomontage im Katalog.1935
Erneute Ausstellung bei D’Audretsch in Den Haag. Kuraufenthalt in den Dolomiten. Lernte in den Dolomiten Kurt Matthies (Pianist, Volkswirtschaftler, 1910–?) kennen. Im Berliner Verlag „Die Rabenpresse“ erschien Til Brugmans Groteskensammlung „Scheingehacktes“ mit Illustrationen von Höch. Trennung von Brugman.1936
Teilnahme an der Ausstellung „Deutsche Frauenkunst der Gegenwart“ im Mannheimer Kunstverein. Im Katalog der Ausstellung „Fantastic Art, Dada, Surrealism“, kuratiert von Alfred Barr im Museum of Modern Art in New York, wurde das „Klebebild XI“, 1921, aus der Sammlung Tristan Tzara abgebildet.1937
Aufnahme als „Kulturbolschewistin“ in Wolfgang Willrichs „Säuberung des Kunsttempels“ mit dem Gemälde „Journalisten“. Höch erhielt „Ausstellungsverbot“. Besuchte in mehreren Städten die Ausstellung „Entartete Kunst“. Zahlreiche Reisen über die Sächsische Schweiz und den Thüringer Wald nach Süd- und Südwestdeutschland an der Seite von Kurt Matthies, der für die jüdische Firma und Eisengießerei Schönthal tätig war. Die Familie Schönthal verkaufte die Firma 1937, emigriert 1938 nach Stockholm und anschließend nach Mexiko. Höch verband ihre Reisen stets mit Museumsbesuchen, zum Beispiel im Landesmuseum Darmstadt, wobei sie Rembrandt, Rubens, Holbein und Böcklin vermerkte, oder die Mannheimer Kunsthalle, dabei vor allem die Franzosen hervorhebend: Daumier, Pissarro, Courbet, Corot. Sie schuf Gemälde, Aquarelle, Skizzen. Dazwischen immer wieder Unterbrechungen in Berlin. Höch gab Kurse in der ehemaligen Reimann-Schule.1938
Heirat mit Kurt Matthies. Zahlreiche Reisen mit ihrem Wohnwagen in Nord- und Westdeutschland. Matthies war nun für die Firma Gussolit tätig, einem Hersteller von Schweißelektroden. Insgesamt unstete Jahre, eine problematische Beziehung. Die politische Situation wie auch die persönlichen Umstände lasteten schwer auf Höchs Gesundheit. Sie berichtete in ihren Tagebüchern von Angstzuständen und Herzbeschwerden. Daneben kommentierte sie kurz und knapp die politischen Ereignisse.1939
Erneut zahlreiche Reisen. Aufenthalte in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Delft, Scheveningen. Museumsbesuche, zum Beispiel im Kröller-Müller-Museum in Otterlo, Stedelijk Museum in Amsterdam, Rijksmuseum, Boymans van Beuningen Museum in Rotterdam. Traf Cornelis van Eesteren, Jan Buijs, Ditte van der Vies. Höch erlebte die Kriegserklärung in Gotha während eines Zwischenaufenthaltes bei ihrer Mutter. Darüber hinaus besucht Höch das Wallraf-Richartz-Museum in Köln, das Folkwang Museum in Essen, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, die Pinakotheken in München, das Städel Museum in Frankfurt am Main, die Hamburger Kunsthalle. Höch traf Freunde, unter anderem Prof. Dr. Hildebrandt, Willi Baumeister und Oskar Schlemmer in Stuttgart, besichtigte die Weissenhofsiedlung. Dank einer kleinen Summe aus der elterlichen Erbschaft erwarb sie ein ehemaliges Flugwärterhäuschen in Berlin-Heiligensee. Höch verbrachte Dokumente und Werke ihrer Freunde aus ehemaligen Dada-Zeiten.1940
Erneut zahlreiche Reisen mit Matthies durch Deutschland und Italien, inklusive Ligurien, Toskana, Rom, Neapel, Padua, Venedig. Traf erneut Willi Baumeister und die Hildebrandts in Stuttgart.1942
Bergtouren in Tirol. Trennung von Matthies.1944
Scheidung. Höch lebte zurückgezogen in Heiligensee, zunehmend vereinsamt. Ihr Garten gewann an Bedeutung, als Ausgleich und zur Ernährung. Wenige Kontakte blieben erhalten, wie zu Thomas Ring, den sie bereits seit der Studienzeit bei Orlik kannte, oder Adolf Behne. Mit beiden pflegte sie in all diesen Jahren einen unregelmäßigen Briefwechsel.1945
Höch berichtete vom Einmarsch der Russen. Sie engagierte sich sofort im kulturellen Wiederaufbau. Im September Einladung zur Gründungsversammlung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschland. Sie lernte Heinz Trökes kennen, den Mitbegründer der Galerie Gerd Rosen, und hielt ihren ersten Vortrag: „Die Symbolik der Kunst“.1946
Als „wichtige Kulturschaffende“ anerkannt. Höch erhielt Anrecht auf eine Lebensmittelkarte I. Versuchte, Kontakte wiederherzustellen. Im Februar „Fantasten“-Ausstellung in der Galerie Gerd Rosen. Mit ihr stellten Hans Uhlmann, Mac Zimmermann, Hans Thiemann, Stephen Alexander und Heinz Trökes aus. Höch verfasste die Einführung zum Katalog, in der sie sich zu einer Sur-Realität bekannte. Mitarbeit am „Ulenspiegel“, der Zeitschrift für Literatur, Kunst und Satire. In der Folge wurden Fotomontagen und Aquarelle abgedruckt. Ihr letzter Beitrag 1949 ist das Aquarell „Der Mensch schreit“. Im Dezember Beteiligung an der Ausstellung „Fotomontage von Dada bis heute“ in der Galerie Gerd Rosen, daneben Arbeiten von Raoul Hausmann, Johannes Baader, Juro Kubicek und anderen. Im Katalog ihr Text zur Fotomontage, bereits verfasst für die Ausstellung in Brünn 1934.1947
Beteiligte sich mit Aquarellen, Collagen und Zeichnungen an der Ausstellung „Phantasie und Illustration“ im Bezirksamt Reinickendorf.1948
Tod Kurt Schwitters’ und Adolf Behnes. Im Herbst war Höch mit drei Fotomontagen in der Ausstellung „Collage“ im Museum of Modern Art in New York vertreten. Sie stellte auch Werke von Baader und Hausmann als Leihgaben zur Verfügung. Über Jahre kämpfte die Künstlerin ums nackte Überleben. Höch beantragte Sozialhilfe, erhielt ein Darlehen aus dem Künstler-Hilfs- und Altersfonds, das sie 1949 zurückzahlen musste. Daher gab sie 1948/49 Kurse an der Volkshochschule Reinickendorf, wobei sie sich ausführlich auf Wilhelm Worringers „Abstraktion und Einfühlung“ bezog.1949
Austritt aus dem Schutzverband bildender Künstler, weil sie sich den Beitrag nicht leisten konnte. Einzelausstellung in der Galerie Franz mit Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Fotomontagen, ergänzt durch Arbeiten von Hausmann, Schwitters, Arp und Freundlich. Höch nahm nun an diversen Gruppenausstellungen teil, zum Beispiel an „Reinickendorfer Künstler stellen aus. Malerei, Graphik, Plastik“ im Volksbildungsamt Reinickendorf 1945 und 1949 im Archivarion an der Milly-Steger-Gedächtnis-Ausstellung sowie an der Graphikausstellung des Bezirksamtes Charlottenburg.1950
Gründung des unabhängigen Berufsverbandes Bildender Künstler in Berlin, mit dabei Hannah Höch. Zahlreiche Bitten der Künstlerin auf Erlass der Mitgliedsbeiträge und Sonderzuschüsse für den Erwerb von Malmaterial. Höch war regelmäßig auf den Ausstellungen vertreten, ebenso bei den Veranstaltungen anderer Verbände, wie „Der Ring“ oder der Verein Berliner Künstler.1951
Wiederaufnahme von Kontakten zu Hausmann, Hans Richter, Richard Huelsenbeck. Verletzte sich das rechte Auge im Garten. Besuchte im Dezember eine Ausstellung von Max Ernst im Haus am Waldsee, den sie als ihren „nächsten ‚Verwandten‘“ bezeichnete.1952
Teilnahme an der ersten „Juryfreien Kunstausstellung in Berlin“ (ebenso 1953–1955 und 1962/1963) und der Weihnachtsverkaufsausstellung der Berliner Künstler im Schloss Charlottenburg (veranstaltet vom Senator für Volksbildung, Abteilung Kunst, und dem Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen Industrie) sowie an der Ausstellung des „Rings“ im Haus am Waldsee. Höch beteiligte sich aktiv am Berliner Kulturleben, besuchte Ausstellungen, Vorträge, Film- und Theatervorführungen. Freundschaft mit dem Schriftsteller Karl Friedrich Borée. Besuch von Hannah Kosnick-Kloss-Freundlich, die Nachrichten aus Paris überbrachte.1953
Teilnahme an der Ausstellung „Landschaft und Stillleben, Porträt und Plastik“ im Rathaus Neukölln sowie an der „Juryfreien Kunstausstellung“ und Reinickendorfer Ausstellungen. Finanzielle Hilfe durch die Deputation für Volksbildung und Kunst des Bezirkamts Reinickendorfs. Erkrankung an Hepatitis. In der Ausstellung „Dada 1916–1923“ bei Sidney Janis in New York waren fünf Werke von Höch dabei. Im November hörte sie ein Interview mit Max Ernst im Radio, das sie tief bewegte. Mehrere Briefentwürfe an Ernst schickte sie nicht ab.1954
Höch war erneut auf der „Juryfreien“ und der Weihnachts-verkaufsausstellung vertreten. Anlässlich ihres 65. Geburtstages und bis zu ihrem Tod erhielt Höch auf Empfehlung von Hans Arp ein „Ehrenruhegeld“ der Stadt Berlin. Höch sah die Ausstellung von Max Ernst in der Galerie Springer.1955
Hannah Höch zeigte Aquarelle und Zeichnungen in der Galerie Spitta & Leutz. Reise ins Rheinland, traf Georg Muche, Max Burchartz, Werner Graeff. Die Galerie des 20. Jahrhunderts, Vorgängerinstitution der Nationalgalerie, erwarb das Ölbild „Die Mücke ist tot“.1956
Hannah Höch beteiligte sich an der internationalen Collage-Ausstellung in der Rose Fried Gallery in New York. Erste Schwitters-Retrospektive in Deutschland. Höch reiste mit dem Galeristen Rudolf Springer nach Hannover. Sie nahm an der „Großen Berliner Kunstausstellung“ teil (ebenso 1957–61) sowie an der vom Ring bildender Künstler Berlins organisierten Ausstellung in Leverkusen. Der „Kleine Zyklus“ wurde von der Galerie des 20. Jahrhunderts erworben. Kontakte zu Kuratoren und Museumsdirektoren: Werner Schmalenbach, Ewald Rathke, Carola Giedion-Welcker, Peter Krieger und Herta Wescher etwa. Hans Bolliger vom Auktionshaus Kornfeld und Klipstein, Schweiz, boten Arbeiten der Künstlerin an. Hannah Höch reiste nach Bern, wo sie Ausstellungen mit Werken von Paul Klee, Egon Schiele und Marc Chagall besuchte.1957
Einzelausstellung Höchs mit 26 Collagen in der Galerie Gerd Rosen, Berlin. Parallel dazu wurde afrikanische Stammeskunst gezeigt. Außerdem Teilnahme an der „Großen Berliner Kunstausstellung“. Höch besaß ein ausgeprägtes Interesse an technischen Entwicklungen. Sie verfolgte mit höchster Aufmerksamkeit die Eroberung des Weltalls, sammelte dazu Artikel und Fotomaterial zu den Bewegungen der ersten russischen Erdsatelliten Sputnik 1 und 2 in der Umlaufbahn. Der Blick von oben – oder außen – auf die Dinge, die Relativierung der Verhältnisse, die innovativen Perspektiven waren der Künstlerin stets von Bedeutung.1958
Ausstellung „Dada – Dokumente einer Bewegung“ in Düsseldorf. Höch wurde mit 21 Arbeiten gezeigt. Auf der Eröffnung am 5. September traf sie Man Ray, Hans Richter, Paul Citroen und Hans Bolliger. Höch galt als zentrale Zeitzeugin. Beteiligung außerdem an der Ausstellung „Berliner Künstler: Malerei, Plastik“, Bezirksamt Spandau.1959
Einzelausstellung Höchs mit 35 Collagen aus den Jahren 1956 bis 1959 in der Galerie Gerd Rosen, Berlin. Interview mit Edouard Roditi für die Zeitschrift „Der Monat“, später abgedruckt in „Dialoge über Kunst“.1960
Hausmann und Huelsenbeck beklagten die mangelnde Würdigung ihrer Bedeutung für Dada. Mitgliedschaft im Deutschen Künstlerbund. Paris-Reise mit Rudolf Springer. Traf Hans Arp, Nelly van Doesburg, Michel Seuphor. In der Ausstellung „Ex-position internationale du surréalisme“ in der Galerie Daniel Cordier war Höch mit dem Gemälde „Die Braut“ vertreten sowie in der Ausstellung „Kunst und Mythos“ in Wiesbaden. Klipstein & Kornfeld in Bern boten Arbeiten von Höch an. Ihr sich nun erweiternder Bekanntenkreis setzte sich aus Physikern, Kunsthistorikern, Musikern, Künstlern, Sammlern, Kritikern, Schriftstellern zusammen.1960
Zu Ehren ihres 70. Geburtstages widmet der „Ring bildender Künstler“ Hannah Höch im Rahmen seiner Ausstellung im Haus am Waldsee eine eigene Sektion. Sie schenkte Arp die Arbeiten „Huldigung an Arp“ und „Schnurbild“. Ausstellung „Kunst des 20. Jahrhunderts aus Berliner Privatbesitz“ mit zahlreichen Leihgaben aus dem Besitz der Künstlerin: eine Plastik von Arp, Otto Freundlichs „Komposition“, Werke von Schwitters, Hausmann und Segal. Erhielt ab März bis an ihr Lebensende finanzielle Unterstützung durch die Deutsche Künstlerhilfe, einem Fonds aus Fördermitteln der Bundesministerien und Spenden. Teilnahme an der Ausstellung „Berlin: Ort der Freiheit für die Kunst“, Berlin, Recklinghausen, Wien, Oslo, Helsinki, sowie an der Ausstellung „Das frühe Bild – Malerei und Plastik“, Baden-Baden, München.1961
Von Januar bis April 1961 war Hannah Höch Ehrengast der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Kontakt zu Palma Bucarelli, Direktorin der Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Rom, sowie zu Arturo Schwarz, Mailand. Höch-Retrospektive in der Galerie Nierendorf, Berlin, von April bis Juni. Die Galerie vertrat nun die Künstlerin. Die Nationalgalerie erwarb „Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands“. Im Sommer entstand der Dokumentarfilm „Hannah Höch – jung geblieben“ von Hans Cürlis. Im Oktober war Höch auf der Ausstellung „The Art of Assemblage“ im Museum of Modern Art vertreten. Die Künstlerin verfolgte weiterhin Neuerungen auf dem Gebiet der Kunst, der Architektur, Film und Fotografie, in Technologie und Atomenergie. Abbildungen einiger Werke mit einem Artikel von Eberhard Ruhmer in „Die Kunst und das schöne Heim“, Monatsschrift für Malerei, Plastik, Graphik, Architektur und Wohnkultur.1962
Höch erhielt zahlreiche Anfragen bezüglich ihrer Dada-Sammlung. Beteiligung an der Ausstellung „Skripturale Malerei“ mit Collagen, Haus am Waldsee, Berlin. Durch den Aufenthalt in Rom Kontakt zu Lothar Fischer. Beteiligung an der Ausstellung „Photo-Graphik“, Die Neue Sammlung in München.1963
Ausstellung „Dada – Hannah Höch – Dada“ in der Mailänder Galleria del Levante und der Galleria d’Arte Moderna „Il Punto“, Turin. Beteiligung an der Ausstellung „Schrift und Bild“, Stedelijk Museum Amsterdam, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, an der Ausstellung „Druckgrafik – farbig und schwarz-weiß“, Deutscher Künstlerbund, Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, sowie an der Präsentation „Kunstdiktatur – gestern und heute“, Berlin, an „Werbegrafik 1920–1930: grafische, typografische, fotografische Experimente der zwanziger Jahre“, Göppinger Galerie, Frankfurt am Main. Reise nach Paris, Treffen mit Nelly van Doesburg und Arp.1964
Höch besuchte die „Documenta III“ in Kassel. Zum 75. Geburtstag organisierte die Galerie Nierendorf eine Retrospektive der Künstlerin. Die Verkäufe dienten dazu, eine Zwangsvollstreckung des Häuschens zu verhindern. Höch musste sich beständig „über Wasser halten“, zum Beispiel durch Privatunterricht im Zeichnen. Beteiligung an der Ausstellung „Behauptung der Kunst“ des Deutschen Künstlerbundes, Haus am Waldsee, Berlin, sowie an der Ausstellung „Cinquante ans de collages: Papiers collés, assemblages, collages, du Cubisme à nos jours“, Musée d’Art et d’Industrie, Saint- Étienne, Musée des Arts Décoratifs, Paris.1965
Hannah Höch pflegte den Kontakt zum italienischen Bildhauer und Berlin-Stipendiaten Emilio Vedova, den sie mehrmals in seinem Berliner Atelier besuchte. Die Abteilung Bildende Kunst der Akademie der Künste, Berlin, wählte Höch zum ordentlichen Mitglied. Beteiligt an den Ausstellungen „Signale, Manifeste, Proteste im 20. Jahrhundert“ im Rahmen der Ruhrfestspiele in der Städtischen Kunsthalle Recklinghausen sowie „Dada bis heute“, Neue Galerie der Stadt Linz, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz. Leihgaben aus dem Besitz von Höch auf der großen Schwitters-Retrospektive in Los Angeles, Kansas City, Toronto, Dallas, St. Louis. Beschäftigung mit den Gemini-Raumflügen.1966
Einzelausstellung Höchs mit Collagen in der Marlborough Gallery in London. Vortrag zur Berliner Dada-Zeit im Kunstverein Düsseldorf. Vermehrt suchten Fluxus-Künstler:innen den Kontakt zu Höch. Unter anderem wurde sie von Nam June Paik und Charlotte Moorman, von Wolf Vostell, Dick und Alison Higgins, von Juan Hidalgo besucht. Dada-Ausstellung im Kunsthaus Zürich und im Musée national d’Art moderne in Paris mit Collagen von Höch. Beteiligte sich an der Gruppenausstellung „Dada“ im Moderna Museet, Stockholm, sowie der Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes in Essen und an „Dada 1916–1966: Dokumente der internationalen Dada-Bewegung“, organisiert vom Goethe-Institut, Galleria d’Arte Moderna Rom.1967
Beteiligung an der Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes in Karlsruhe, an der Ausstellung „Collage 67“ in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, München, den Ausstellungen „Berlin – zwanziger Jahre: Malerei, Grafik, Plastik“, Bonn, Berlin, „Fetisch-Formen“ der Deutschen Gesellschaft für Bildende Kunst, Leverkusen, Berlin (mit Schwitters-Leihgaben). Eberhard Roters, späterer Gründungsdirektor der Berlinischen Galerie, beauftragte Heinz Ohff mit der Erstellung einer ersten Biografie zu Höch. 1967, 1968 und 1978 erhielt Höch eine Spende der Theodor-Heuss-Stiftung.1968
Höch nahm an der Ausstellung „Dada, Surrealism, and Their Heritage“ im Museum of Modern Art in New York, im Los Angeles County Museum of Arts und dem The Art Institute of Chicago teil. Ihre Arbeiten wurden erwähnt und abgebildet in der gleichnamigen Publikation von William S. Rubin. Auch in einer zweiten MoMA-Ausstellung war Höch in diesem Jahr vertreten: „The Machine, as Seen at the End of the Mechanical Age“, die danach noch in der Rice University, der University of St. Thomas und im San Francisco Museum of Art gezeigt wurde. Es erschien die erste Monografie zu Höch von Heinz Ohff, erster Band der Reihe „Bildende Kunst in Berlin“, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Bildende Kunst (Kunstverein Berlin) und von der Stiftung Buchkunst unter die schönsten Bücher des Jahres gereiht. Erste Einzelausstellung im Bezirk Reinickendorf: „Hannah Höch: Zeichnungen, Aquarelle, Linol-schnitte aus den Jahren 1915–1965“, Kunstamt Reinickendorf, Galerie im Schinkelsaal Tegel. Daneben Beteiligung an „Collagen aus sechs Jahrzehnten“, Frankfurt am Main, und an der Ausstellung der „Juryfreien“ in Berlin. Das Berliner Kupferstichkabinett zeigte „Graphik des XX. Jahrhunderts: Neuerwerbungen des Berliner Kupferstichkabinetts 1958–1968“, darunter das Miniaturenkonvolut Höchs. Werke von Höch waren vertreten in „Realismus in der Malerei der 20er Jahre“, Kunstverein Hamburg, Frankfurter Kunstverein; „Greenwich – Maribor – Reinickendorf“, Maribor; „Berlin XXe siècle: de l’expressionnisme à l’art contemporain“, Lausanne; „Akademie 1968“, Akademie der Künste, Berlin, sowie „Von der Collage zur Assemblage“, Institut für moderne Kunst und Städtische Kunstsammlungen / Kunsthalle Nürnberg.1969
Retrospektive Höchs im Kasseler Kunstverein. Des Weiteren waren Arbeiten von Höch in den Ausstellungen „Industrie und Technik in der deutschen Malerei von der Romantik bis zur Gegenwart“ (Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duisburg) und „Die Fotomontage: Geschichte und Wesen einer Kunstform“, Ingolstadt, zu sehen. Festveranstaltung zu ihrem 80. Geburtstag in der Akademie der Künste, Berlin. Reges Interesse an den Apollo-Landungen auf dem Mond. Weiterhin Beteiligung an Weihnachtsverkaufsausstellungen. Helga Kliemann veröffentlichte Werke von Höch in ihrer monografischen Untersuchung zur Novembergruppe, Wieland Schmied in seinem Buch „Neue Sachlichkeit und Magischer Realismus in Deutschland 1918–1933“.1970
Die Deutsche Welle sendete am 2. Juli „Das Porträt: Hannah Höch“. Es stellten sich Probleme mit der Sehkraft ein. Beteiligung an „Künstler sehen Reinickendorf“ im Rathaus Reinickendorf. Sammelte Material zu diversen Themen, die sie in Rubriken unterteilte, wie Astronautik, Mikrokosmos, Pflanzen, Blumen, aber auch Religion und Sex, für eine große Collage.1971
Hannah Höch beteiligte sich mit Collagen an der Wanderausstellung „Metamorphose des Dinges. Kunst und Antikunst 1910–1970“ (1971–1972 in Brüssel, Rotterdam, Berlin, Mailand, Basel, Paris). Umfangreiche Retrospektive zu ihren Ehren in der Akademie der Künste, Berlin (anschließend in der Städtischen Kunsthalle Düsseldorf). Ernennung zum Mitglied des Ehrenvorstandes des Deutschen Künstlerbundes. Der Sender Freies Berlin brachte das Interview „Alt werden, jung bleiben“. Höch sammelte weiterhin Artikel und Material zu zahlreichen Themen, unter anderem zu Gesteinsproben auf dem Mond, zu Parapsychologie und zeitgenössischer Musik und Tanz.1972
Höch begann mit der Großcollage „Lebensbild“. Leihgaben in der Ausstellung „Salomo Friedlaender / Mynona“, Akademie der Künste, Berlin. Beteiligte sich an der Ausstellung „240 Werke von 40 Meistern des 20. Jahrhunderts“, Galerie Nierendorf, Berlin.1973
Gespräch mit Wolfgang Pehnt in der Reihe „Jene zwanziger Jahre“ im Deutschlandfunk (4.3.). Ein Filmporträt von Sigurd Kuschnerus wurde im Sender Freies Berlin am 23. November ausgestrahlt. Einzelausstellung Höchs in den Städtischen Sammlungen Rheinhausen mit Aquarellen und Zeichnungen, ebenso in der Kunsthalle Bielefeld: „Hannah Höch: Fotomontagen und Gemälde“. Beteiligte sich an „Medium Fotografie: Fotoarbeiten bildender Künstler von 1910 bis 1973“, Städtisches Museum Schloss Morsbroich, Leverkusen, Kunstverein Hamburg, Haus am Waldsee, Berlin, sowie an „Das kleinste Museum der Welt – Tabu Format“, Kunstverein Wolfsburg.1974
Umfassende Höch-Ausstellung des Goethe-Instituts im Nationalmuseum für Moderne Kunst, Kyoto. Höch erhielt eine Ehrenprofessur der Akademie der Künste, Berlin. Operation am grauen Star. Arbeitete nun mit einem Vergrößerungsglas. Der Senat für Wissenschaft und Kunst erwarb die Gemälde „Roma“ und „Journalisten“. Werke von Höch waren vertreten in „Realismus und Sachlichkeit: Aspekte deutscher Kunst 1919–1933“, Nationalgalerie und Kupferstichkabinett Berlin, sowie in der Großen Kunstausstellung in München und der Ausstellung „Vordemberge-Gildewart: Remembered“, London.1975
Beteiligung an der Ausstellung „Als der Krieg zu Ende war: Kunst in Deutschland 1945–1950“ in der Akademie der Künste, Berlin. Einzelausstellung „Hannah Höch: Noch nicht gezeigte Blätter: Aquarelle, Collagen, Zeichnungen“, Galerie Nierendorf, Berlin. Teilnahme an „Stillleben aus der deutschen Malerei des XX. Jahrhunderts“, Hessisches Landesmuseum in Darmstadt, „Deutsche bildende Künstlerinnen von der Goethezeit bis zur Gegenwart“, Nationalgalerie der DDR, Berlin (Ost), „Berlinische Galerie: Sammlungen zur bildenden Kunst und Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts“, Akademie der Künste, Berlin, „Graphotheka 29“, Bezirksamt Reinickendorf, Berlin.1976
Umfangreiche Retrospektive Höchs im Musée d’Art moderne de la ville de Paris, Centre Culturel Allemand des Goethe-Instituts Paris und in der Nationalgalerie Berlin. Ernennung zum „Professor ehrenhalber“ durch den Berliner Senat. Ausstellung „Hannah Höch: Gemälde, Aquarelle, Gouachen, Zeichnungen, Collagen“, Muzeum Sztuki, Lodz. Beteiligungen an „Sommer 1976: 240 Werke von 50 Künstlern des 20. Jahrhunderts“, Galerie Nierendorf, Berlin; „Berliner Malerei der zwanziger Jahre: eine Ausstellung der Berlinischen Galerie“, Haus an der Redoute, Bonn-Bad Godesberg; „Deutsche Zeichnungen der klassischen Moderne aus der Nationalgalerie Berlin“, Städtisches Kunstmuseum Bonn.1977
Arbeiten von Höch waren auf den Ausstellungen „Women Artists: 1550–1950“ im Los Angeles County Museum of Art zu sehen (weitere Stationen: University Art Museum, Austin; Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; The Brooklyn Museum, New York) und „Künstlerinnen international 1877–1977“ (Neue Gesellschaft für bildende Kunst in Berlin). Fotomontagen und Collagen wurden außerdem in einer gesonderten Präsentation im Rahmen der Ausstellung „Berlin Now“, organisiert vom Goethe-Institut, in New York gezeigt. Des Weiteren waren ihre Arbeiten vertreten auf der 15. Europäischen Kunstausstellung „Tendenzen der Zwanziger Jahre“ in der Sektion „Dada in Europa – Werke und Dokumente“. Leihgaben aus dem Besitz von Höch waren dabei in der Ausstellung „Deutsche Bildhauer 1900–1933“, Wilhelm-Lehmbruck- Museum Duisburg, Kunstmuseum Bukarest, Pfalzgalerie Kaiserslautern. Mit eigenen Arbeiten beteiligt an „Die dreißiger Jahre: Schauplatz Deutschland“, Haus der Kunst München, Museum Folkwang Essen, Kunsthaus Zürich, sowie „Sommer 1977: 240 Werke von 30 Künstlern des 20. Jahrhunderts“, Galerie Nierendorf, Berlin, und „Der Anteil der Frau an der Kunst der 20er Jahre: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphik und Plastik“, Galerie Pels-Leusden, Berlin.1978
Einzelausstellungen „Hannah Höch. Aquarelle“, Graphothek, Tegel-Center, Berlin, und „Hannah Höch: Ein Leben mit der Pflanze“, Städtische Kunstsammlung Gelsenkirchen. Werke von Höch waren vertreten in „Dada and Surrealism Reviewed“, Arts Council, Hay-ward Gallery, London, ebenso wie in „Paris – Berlin 1900–1933: Rapports et Contrastes France – Allemagne“, Centre Pompidou, Paris.31.5.1978
Hannah Höch starb am 31. Mai im Alter von 88 Jahren.
- Der Architekturhistoriker Matthias Noell verfolgte die Auswirkungen dieser Prinzipien bis in die Architekturmoderne des 20. Jahrhunderts, unter deren namhaften Vertretern sich zahlreiche Bewunderer Fröbels befinden.
- Hannah Höch im Gespräch mit Wolfgang Pehnt. Deutschlandfunk, 4. März 1973, 9.30 Uhr.
- Brief von Hannah Höch an ihre Schwester Grete König vom 18.11.1916, Nachlass Privatbesitz. Zit. n. Hannah Höch, S. XX.
- Eberhard Roters, Novembergruppe, in: Lebenscollage, Bd. II, 1. Abt., 1995, S. 75–96, hier S. 76.
- Hannah Höch. Aller Anfang ist DADA!, hg. v. Ralf Burmeister (Ausst.-Kat. Berlinische Galerie, Berlin, Museum Tinguely, Basel), Ostfildern-Ruit 2007, S. 167.
- Lebenscollage, Bd. I, 2. Abt., 1989, S. 635.
- Eberhard Roters, Dada – Ausklang und Nachhall, in: Lebenscollage, Bd. II, 1. Abt., 1995, S. 19–74, hier S. 23.
- Burmeister (2007), S. 170.
- Lebenscollage, Bd. II, 2. Abt., 1995, S. 164, Nr. 24.19, S. 166, Anm. 7.
- Lebenscollage, Bd. II, 2. Abt., Berlin 1995, S. 241, Nr. 25.54.
- Vgl. Eva Züchner, Jeder Tag ein Kampf. Die Nachkriegsjahre 1946–1949, in: Lebenscollage, Bd. III, 1. Abt., Berlin 2001, S. 36–77, hier insbes. S. 62.
