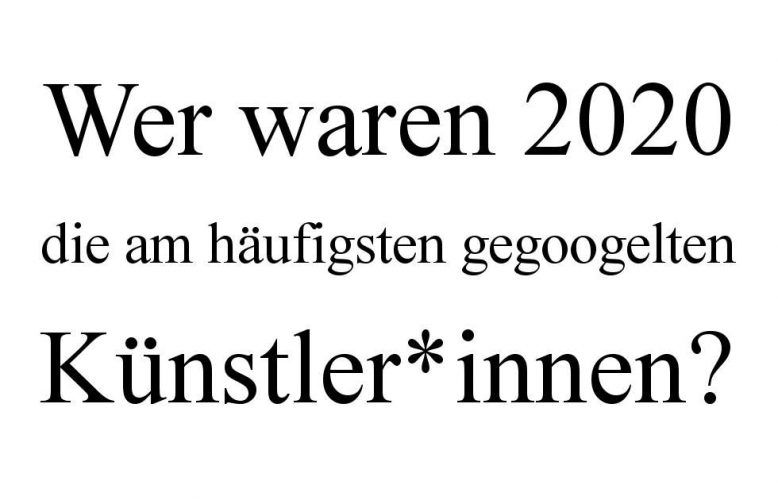Katharina Grosse
Wer ist Katharina Grosse?
Katharina Grosse (* 2.10.1961 in Freiburg im Breisgau) ist eine deutsche Künstlerin der Gegenwart (→ Zeitgenössische Kunst). Sie gilt als eine der einflussreichsten Malerinnen der zeitgenössischen Kunst und überzeugt mit monumentalen, ortsbezogenen, Installationen, in denen Architektur, Skulptur und Malerei eine Einheit bilden. Katharina Grosses Werke bieten visuelle Erlebnisse, die sich einer einfachen Beschreibung entziehen.
Seit den späten 1990er Jahren verwendet sie ein industrielles Farbsprühgerät, um prismatische Farbschwaden auf eine Vielzahl von Oberflächen aufzutragen. Dabei verwendet Grosse oft helle, unvermischte aufgesprühte Acrylfarben, um sowohl großformatige skulpturale Elemente als auch kleinere Wandarbeiten zu schaffen.
Katharina Grosse lebt und arbeitet in Berlin sowie in Neuseeland.
Kindheit
Katharina Grosse wurde am 2. Oktober 1961 als Tochter der Künstlerin Barbara Grosse und des Germanisten und späteren Rektors der Ruhr-Universität Bochum Siegfried Grosse geboren. Sie besuchte die Schule in Bochum.
Ausbildung
Katharina Grosse studierte an den Kunstakademien Münster und Düsseldorf bei Norbert Tadeusz (1940–2011 → Münster | LWL-Museum: Norbert Tadeusz) und Gotthard Graubner (1930–2013).
Werke
Katharina Grosse verwendet für ihre Malerei eine mit Kompressor betriebene Spritzpistole. Die ersten mit der Spritzpistolen-Technik gemalten Wandarbeiten schuf Grosse 1998 in Sydney als Beitrag zur 11th Biennale of Sydney oder im selben Jahr in der Kunsthalle Bern. In den Folgejahren besprayte Grosse größere Flächen, die sich ab 2001 auch im Außenraum fortsetzen. Die installativen Dispositionen der Arbeiten werden dabei immer komplexer: Boden und Decke werden mit zum Malgrund, Schutt und Stein wird aufgeschüttet, Möbelstücke, Stoffe, Objekte und Gegenstände einbezogen. Museen, Privathäuser, Plakatflächen, Treppenhäuser, Kantinen und Trainingsräume wurden bemalt. Die Sprayarbeiten schaffen Kontrapunkte und Irritationen, die eine Illusion, eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit, schaffen.
Groß und ausdrucksstark erzeugen Grosses Bilder durch ihre emphatische materielle Präsenz gesteigerte Sinneswahrnehmungen. Sie sprengen die konventionellen Beziehungen von Hintergrund und Vordergrund, Oberfläche und Untergrund, Leinwand und Bildrand, um neue imaginäre Welten innerhalb und außerhalb des Kunstwerks zu eröffnen. Flecken, Streifen, Schwaden und Farbnebel; komplexe Farbschichten; ausladende raumgreifende Bewegungen; und flüssige, abstrakte Formen vermitteln eine gleichzeitige Vielfalt, die sowohl intuitive als auch unterschwellige Wahrnehmungen mobilisiert. Der Akt des Malens, von Grosse als Prototyp menschlicher Aktivität konzipiert, und die Art und Weise, wie sie Subjektivität und Selbstbewusstsein herausfordert, die seit langem untrennbar mit dem Medium Malerei verbunden sind, können als Mittel zur Abrechnung mit der Welt jenseits der Leinwand verstanden werden.
Für die deutsche „Vogue“ gestaltete Grosse zusammen mit der Schriftstellerin Annika Reich die Januar-Ausgabe 2020 unter dem Titel „Imagine: Wir machen das“.
Lehre
Katharina Grosse war Professorin an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee (2000–2009) und Professorin für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf (2010–2018).
Ehrungen
- 2015: Otto-Ritschl-Preis, Wiesbaden
- 2014: Oskar-Schlemmer-Preis, Land Baden-Württemberg
- 2010: Mitglied der Akademie der Künste in Berlin
- 2003: Fred-Thieler-Preis
- 1995: Stipendiatin der Stiftung Kunstfonds
- 1993: Schmidt-Rottluff-Stipendium
- 1992: Villa-Romana-Stipendium, Florenz
Literatur zu Katharina Grosse
- Katharina Grosse, hg. v. Katharina Grosse, Ulrich Loock, Annika Reich, mit einem Text von Ulrich Loock, Köln 2013.